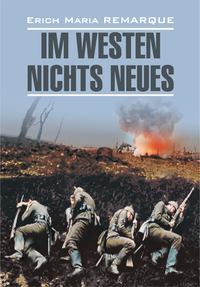
Im Westen nichts Neues / На Западном фронте без перемен. Книга для чтения на немецком языке
Albert kommt zurück. »Meint ihr – ?« fragt er.
»Erledigt«, sagt Müller abschließend.
Wir gehen zu unsern Baracken zurück. Ich denke an den Brief, den ich morgen schreiben muss an Kemmerichs Mutter. Mich friert. Ich möchte einen Schnaps trinken. Müller rupft Gräser aus und kaut daran. Plötzlich wirft der kleine Kropp seine Zigarette weg, trampelt wild darauf herum, sieht sich um, mit einem aufgelösten und verstörten Gesicht, und stammelt: »Verfluchte Scheiße, diese verfluchte Scheiße.«
Wir gehen weiter, eine lange Zeit. Kropp hat sich beruhigt, wir kennen das, es ist der Frontkoller*, jeder hat ihn mal. Müller fragt ihn: »Was hat dir der Kantorek eigentlich geschrieben?«
Er lacht: »Wir wären die eiserne Jugend.«
Wir lachen alle drei ärgerlich. Kropp schimpft; er ist froh, dass er reden kann. —
Ja, so denken sie, so denken sie, die hunderttausend Kantoreks! Eiserne Jugend. Jugend! Wir sind alle nicht mehr als zwanzig Jahre. Aber jung? Jugend? Das ist lange her. Wir sind alte Leute.
Aufgaben zum Text
1. Wie verstehen Sie den Vorspruch zum Roman? Was nehmen Sie an, worum geht es im Roman?
2. Beschreiben Sie die neuen Freunde.
3. Wofür freueten sich die Freunde? Und warum war der Furier erschlagen?
4. Beschreiben Sie die Natur und das Wetter an jenem Tag. Welche Rolle spielt hier die Naturbeschreibung?
5. Was erfahren Sie über Kantorek?
6. Wer ist Behm? Warum wird sein Tod so ausführlich geschildert?
7. Wie hat der Krieg die Weltanschauung der achtzehnjährigen Jungen geändert?
8. Wie glauben Sie, warum nennen sich die Achtzehnjährigen „alte Leute“?
9. Warum ist im Roman die Episode mit Kemmerichs Stiefeln so ausführlich geschildert?
Texterläuterungen
Küchenbulle, der – jemand, der das Essen für die Soldaten ausgibt, Koch
Gulaschkanone, die – scherzhaft für die Küche
langen – etwas ist in genügendem Maß vorhanden; etwas reicht aus, genügt
splendid – freigebig
Furier, der – der für die Verpflegung und Unterkunft sorgende Unteroffizier
Quantum, das – die Menge von etwas, die angemessen ist
Langrohr, das – Langrohrartellerie
dicke Brocken – großkalibrige Geschosse
Gefreite, der – ein Soldat mit dem zweitniedrigsten Rang
Puff, das / der – (gesprochen) Bordell
Wanze, die – ein flaches Insekt, das Pflanzensäfte oder das Blut von Menschen und Tieren saugt
Kommiss, der – (veraltend, gesprochen, pejorativ) Militär(dienst)
Schwein haben – (gespr.) Glück, das man nicht verdient hat
Kleinholz geben – prügeln
Speckjäger, der – Schimpfwort
platzen – etwas platzt: etwas geht plötzlich (oft mit einem Knall) kaputt, meist weil der Druck im Inneren zu stark geworden ist
Latrine, die – eine Toilette im Freien, bei der die Exkremente in eine Grube fallen
Verdauung, die – das Verdauen der Nahrung (verdauen – die Nahrung im Magen und im Darm auflösen, so dass der Körper sie aufnehmen kann)
entrüsten – sich über etwas sehr ärgern (und diesen Ärger auch zeigen)
Flack, die – Kurzform für die Flugzeugabwehrkanone
Garbe, die – mehrere Schüsse (aus einer automatischen Schusswaffe), die rasch aufeinander folgen
Skat, der – das beliebteste deutsche Kartenspiel für drei Personen
Nullouvert, der – Null uff’s Ferd, eine bestimmte Kombination von Karten beim Skatspiel (offenes Nullspiel)
Schieberamsch, der – eine inoffizielle Variante des Kartenspiels Skat
Schinder, der – jemand, der ein Tier quält, besonders indem man es sehr hart arbeiten lässt
parat – so, dass man es (zur Hand) hat, wenn man es braucht; (griff)bereit
großer Betrieb – die Aktivitäten und Arbeiten, die an einer Stelle oder in einer Institution ablaufen
Eiter, der – eine dicke, gelbliche Flüssigkeit, die in infizierten Wunden entsteht
flau sein – jemandem ist flau: jemand fühlt sich nicht wohl, ihm ist ein wenig übel oder schwindlig
Trichter, der – ein großes Loch im Erdboden, das durch die Explosion einer Bombe entstanden ist
Tornister, der – ein flaches Gepäckstück, das meist Soldaten auf dem Rücken tragen
Plattfuß, der – ein Fuß, bei dem die ganze Sohle den Boden berührt, wenn man geht
Koller, der – Wutanfall, Wutausbruch
2
Es ist für mich sonderbar, daran zu denken, dass zu Hause, in einer Schreibtischlade, ein angefangenes Drama »Saul*« und ein Stoß* Gedichte liegen. Manchen Abend habe ich darüber verbracht, wir haben ja fast alle so etwas Ähnliches gemacht; aber es ist mir so unwirklich geworden, dass ich es mir nicht mehr richtig vorstellen kann.
Seit wir hier sind, ist unser früheres Leben abgeschnitten, ohne dass wir etwas dazu getan haben. Wir versuchen manchmal, einen Überblick und eine Erklärung dafür zu gewinnen, doch es gelingt uns nicht recht. Gerade für uns Zwanzigjährige ist alles besonders unklar, für Kropp, Müller, Leer, mich, für uns, die Kantorek als eiserne Jugend bezeichnet. Die älteren Leute sind alle fest mit dem Früheren verbunden, sie haben Grund, sie haben Frauen, Kinder, Berufe und Interessen, die schon so stark sind, dass der Krieg sie nicht zerreißen kann. Wir Zwanzigjährigen aber haben nur unsere Eltern und manche ein Mädchen. Das ist nicht viel – denn in unserm Alter ist die Kraft der Eltern am schwächsten, und die Mädchen sind noch nicht beherrschend. Außer diesem gab es ja bei uns nicht viel anderes mehr; etwas Schwärmertum*, einige Liebhabereien* und die Schule; weiter reichte unser Leben noch nicht. Und davon ist nichts geblieben.
Kantorek würde sagen, wir hätten gerade an der Schwelle des Daseins gestanden. So ähnlich ist es auch. Wir waren noch nicht eingewurzelt. Der Krieg hat uns weggeschwemmt. Für die andern, die älteren, ist er eine Unterbrechung, sie können über ihn hinausdenken. Wir aber sind von ihm ergriffen worden und wissen nicht, wie das enden soll. Was wir wissen, ist vorläufig nur, dass wir auf eine sonderbare und schwermütige Weise verroht sind, obschon wir nicht einmal oft mehr traurig werden.
Wenn Müller gern Kemmerichs Stiefel haben will, so ist er deshalb nicht weniger teilnahmsvoll als jemand, der vor Schmerz nicht daran zu denken wagte. Er weiß nur zu unterscheiden. Würden die Stiefel Kemmerich etwas nutzen, dann liefe Müller lieber barfuß über Stacheldraht, als groß zu überlegen, wie er sie bekommt. So aber sind die Stiefel etwas, das gar nichts mit Kemmerichs Zustand zu tun hat, während Müller sie gut verwenden kann. Kemmerich wird sterben, einerlei, wer sie erhält. Warum soll deshalb Müller nicht dahinter her sein, er hat doch mehr Anrecht darauf als ein Sanitäter! Wenn Kemmerich erst tot ist, ist es zu spät. Deshalb passt Müller eben jetzt schon auf.
Wir haben den Sinn für andere Zusammenhänge verloren, weil sie künstlich sind. Nur die Tatsachen sind richtig und wichtig für uns. Und gute Stiefel sind selten.
* * *Früher war auch das anders. Als wir zum Bezirkskommando gingen, waren wir noch eine Klasse von zwanzig jungen Menschen, die sich, manche zum ersten Male, übermütig gemeinsam rasieren ließ, bevor sie den Kasernenhof betrat. Wir hatten keine festen Pläne für die Zukunft, Gedanken an Karriere und Beruf waren bei den wenigsten praktisch bereits so bestimmt, dass sie eine Daseinsform bedeuten konnten; – dafür jedoch steckten wir voll Ungewisser Ideen, die dem Leben und auch dem Kriege in unseren Augen einen idealisierten und fast romantischen Charakter verliehen.
Wir wurden zehn Wochen militärisch ausgebildet und in dieser Zeit entscheidender umgestaltet als in zehn Jahren Schulzeit. Wir lernten, dass ein geputzter Knopf wichtiger ist als vier Bände Schopenhauer*. Zuerst erstaunt, dann erbittert und schließlich gleichgültig erkannten wir, dass nicht der Geist ausschlaggebend zu sein schien, sondern die Wichsbürste*, nicht der Gedanke, sondern das System, nicht die Freiheit, sondern der Drill*. Mit Begeisterung und gutem Willen waren wir Soldaten geworden; aber man tat alles, um uns das auszutreiben. Nach drei Wochen war es uns nicht mehr unfasslich, dass ein betresster Briefträger mehr Macht über uns besaß als früher unsere Eltern, unsere Erzieher und sämtliche Kulturkreise von Plato bis Goethe* zusammen. Mit unseren jungen, wachen Augen sahen wir, dass der klassische Vaterlandsbegriff unserer Lehrer sich hier vorläufig realisierte zu einem Aufgeben der Persönlichkeit, wie man es dem geringsten Dienstboten nie zugemutet haben würde. Grüßen, Strammstehen, Parademarsch, Gewehrpräsentieren, Rechtsum, Linksum, Hackenzusammenschlagen, Schimpfereien und tausend Schikanen*: wir hatten uns unsere Aufgabe anders gedacht und fanden, dass wir auf das Heldentum wie Zirkuspferde vorbereitet wurden. Aber wir gewöhnten uns bald daran. Wir begriffen sogar, dass ein Teil dieser Dinge notwendig, ein anderer aber ebenso überflüssig war. Der Soldat hat dafür eine feine Nase*.
* * *Zu dreien und vieren wurde unsere Klasse über die Korporalschaften* verstreut, zusammen mit friesischen* Fischern, Bauern, Arbeitern und Handwerkern, mit denen wir uns schnell anfreundeten. Kropp, Müller, Kemmerich und ich kamen zur neunten Korporalschaft, die der Unteroffizier Himmelstoß führte.
Er galt als der schärfste Schinder des Kasernenhofes, und das war sein Stolz. Ein kleiner, untersetzter Kerl, der zwölf Jahre gedient hatte, mit fuchsigem, aufgewirbeltem Schnurrbart, im Zivilberuf Briefträger. Auf Kropp, Tjaden, Westhus und mich hatte er es besonders abgesehen, weil er unsern stillen Trotz spürte.
Ich habe an einem Morgen vierzehnmal sein Bett gebaut. Immer wieder fand er etwas daran auszusetzen und riss es herunter. Ich habe in zwanzigstündiger Arbeit – mit Pausen natürlich – ein Paar uralte, steinharte Stiefel so butterweich geschmiert, dass selbst Himmelstoß nichts mehr daran auszusetzen fand; – ich habe auf seinen Befehl mit einer Zahnbürste die Korporalschaftsstube sauber geschrubbt; – Kropp und ich haben uns mit einer Handbürste und einem Fegeblech an den Auftrag gemacht, den Kasernenhof vom Schnee reinzufegen, und wir hätten durchgehalten bis zum Erfrieren, wenn nicht zufällig ein Leutnant aufgetaucht wäre, der uns fortschickte und Himmelstoß mächtig anschnauzte. Die Folge war leider nur, dass Himmelstoß um so wütender auf uns wurde. Ich habe vier Wochen hintereinander jeden Sonntag Wache geschoben und ebensolange Stubendienst gemacht; – ich habe in vollem Gepäck mit Gewehrauf losem, nassem Sturzacker »Sprung auf, marsch, marsch« und »Hinlegen« geübt, bis ich ein Dreckklumpen war und zusammenbrach; – ich habe vier Stunden später Himmelstoß mein tadellos gereinigtes Zeug vorgezeigt, allerdings mit blutig geriebenen Händen; – ich habe mit Kropp, Westhus und Tjaden ohne Handschuhe bei scharfem Frost eine Viertelstunde »Stillgestanden« geübt, die bloßen Finger am eisigen Gewehrlauf, lauernd umschlichen von Himmelstoß, der auf die geringste Bewegung wartete, um ein Vergehen festzustellen; – ich bin nachts um zwei Uhr achtmal im Hemd vom ob ersten Stock der Kaserne heruntergerannt bis auf den Hof, weil meine Unterhose einige Zentimeter über den Rand des Schemels hinausragte, auf dem jeder seine Sachen aufschichten musste. Neben mir lief der Unteroffizier vom Dienst, Himmelstoß, und trat mir auf die Zehen; – ich habe beim Bajonettieren* ständig mit Himmelstoß fechten müssen, wobei ich ein schweres Eisengestell und er ein handliches Holzgewehr hatte, so dass er mir bequem die Arme braun und blau schlagen konnte; allerdings geriet ich dabei einmal so in Wut, dass ich ihn blindlings* überrannte und ihm einen derartigen Stoß vor den Magen gab, dass er umfiel. Als er sich beschweren wollte, lachte ihn der Kompanieführer aus und sagte, er solle doch aufpassen; erkannte seinen Himmelstoß und schien ihm den Reinfall zu gönnen. – Ich habe mich zu einem perfekten Kletterer auf die Spinde entwickelt; – ich suchte allmählich auch im Kniebeugen meinen Meister; – wir haben gezittert, wenn wir nur seine Stimme hörten, aber kleingekriegt hat uns dieses wildgewordene Postpferd nicht.
Als Kropp und ich im Barackenlager sonntags an einer Stange die Latrineneimer über den Hof schleppten und Himmelstoß, blitzblank geschniegelt, zum Ausgehen bereit, gerade vorbeikam, sich vor uns hinstellte und fragte, wie uns die Arbeit gefiele, markierten wir trotz allem ein Stolpern und gössen ihm den Eimer über die Beine. Er tobte, aber das Maß war voll.
»Das setzt Festung«, schrie er.
Kropp hatte genug. »Vorher aber eine Untersuchung, und da werden wir auspacken«, sagte er.
»Wie reden Sie mit einem Unteroffizier!« brüllte Himmelstoß, »sind Sie verrückt geworden? Warten Sie, bis Sie gefragt werden! Was wollen Sie tun?«
»Über Herrn Unteroffizier auspacken!« sagte Kropp und nahm die Finger an die Hosennaht.
Himmelstoß merkte nun doch, was los war, und schob ohne ein Wort ab. Bevor er verschwand, krakehlte er zwar noch: »Das werde ich euch eintränken«, – aber es war vorbei mit seiner Macht. Er versuchte es noch einmal in den Sturzäckern mit »Hinlegen« und »Sprung auf, marsch, marsch«. Wir befolgten zwar jeden Befehl; denn Befehl ist Befehl, er muss ausgeführt werden. Aber wir führten ihn so langsam aus, dass Himmelstoß in Verzweiflung geriet.
Gemütlich gingen wir auf die Knie, dann auf die Arme und so fort; inzwischen hatte er schon wütend ein anderes Kommando gegeben. Bevor wir schwitzten, war er heiser. Er ließ uns dann in Ruhe. Zwar bezeichnete er uns immer noch als Schweinehunde. Aber es lag Achtung darin.
Es gab auch viele anständige Korporale, die vernünftiger waren; die anständigen waren sogar in der Überzahl. Aber vor allem wollte jeder seinen guten Posten hier in der Heimat so lange behalten wie möglich, und das konnte er nur, wenn er stramm mit den Rekruten war.
Uns ist dabei wohl jeder Kasernenhofschliff zuteil geworden, der möglich war, und oft haben wir vor Wut geheult. Manche von uns sind auch krank dadurch geworden. Wolf ist sogar an Lungenentzündung gestorben. Aber wir wären uns lächerlich vorgekommen, wenn wir klein beigegeben hätten. Wir wurden hart, misstrauisch, mitleidlos, rachsüchtig, roh – und das war gut; denn diese Eigenschaften fehlten uns gerade. Hätte man uns ohne diese Ausbildungszeit in den Schützengraben geschickt, dann wären wohl die meisten von uns verrückt geworden. So aber waren wir vorbereitet für das, was uns erwartete.
Wir zerbrachen nicht, wir passten uns an; unsere zwanzig Jahre, die uns manches andere so schwer machten, halfen uns dabei. Das Wichtigste aber war, dass in uns ein festes, praktisches Zusammengehörigkeitsgefühl erwachte, das sich im Felde dann zum Besten steigerte, was der Krieg hervorbrachte: zur Kameradschaft!
* * *Ich sitze am Bette Kemmerichs. Er verfällt mehr und mehr. Um uns ist viel Radau*. Ein Lazarettzug ist angekommen, und die transportfähigen Verwundeten werden ausgesucht. An Kemmerichs Bett geht der Arzt vorbei, er sieht ihn nicht einmal an.
»Das nächstemal, Franz«, sage ich.
Er hebt sich in den Kissen auf die Ellbogen. »Sie haben mich amputiert.«
Das weiß er also doch jetzt. Ich nicke und antworte:
»Sei froh, dass du so weggekommen bist.«
Er schweigt.
Ich rede weiter: »Es konnten auch beide Beine sein, Franz. Wegeler hat den rechten Arm verloren. Das ist viel schlimmer. Du kommst ja auch nach Hause.«
Er sieht mich an. »Meinst du?«
»Natürlich.«
Er wiederholt: »Meinst du?«
»Sicher, Franz. Du musst dich nur erst von der Operation erholen.«
Er winkt mir, heranzurücken. Ich beuge mich über ihn, und er flüstert: »Ich glaube es nicht.«
»Rede keinen Quatsch, Franz, in ein paar Tagen wirst du es selbst einsehen. Was ist das schon groß: ein amputiertes Bein; hier werden ganz andere Sachen wieder zurechtgepflastert.«
Er hebt eine Hand hoch. »Sieh dir das mal an, diese Finger.«
»Das kommt von der Operation. Futtere nur ordentlich, dann wirst du schon aufholen. Habt ihr anständige Verpflegung?«
Er zeigt auf eine Schüssel, die noch halb voll ist. Ich gerate in Erregung. »Franz, du musst essen. Essen ist die Hauptsache. Das ist doch ganz gut hier.«
Er wehrt ab. Nach einer Pause sagt er langsam: »Ich wollte mal Oberförster werden.«
»Das kannst du noch immer«, tröste ich. »Es gibt jetzt großartige Prothesen, du merkst damit gar nicht, dass dir etwas fehlt. Sie werden an die Muskeln angeschlossen. Bei Handprothesen kann man die Finger bewegen und arbeiten, sogar schreiben. Und außerdem wird da immer noch mehr erfunden werden.«
Er liegt eine Zeitlang still. Dann sagt er: » Du kannst meine Schnürschuhe für Müller mitnehmen.«
Ich nicke und denke nach, was ich ihm Aufmunterndes sagen kann. Seine Lippen sind weggewischt, sein Mund ist größer geworden, die Zähne stechen hervor, als wären sie aus Kreide. Das Fleisch zerschmilzt, die Stirn wölbt sich stärker, die Backenknochen stehen vor. Das Skelett arbeitet sich durch. Die Augen versinken schon. In ein paar Stunden wird es vorbei sein.
Er ist nicht der erste, den ich so sehe; aber wir sind zusammen aufgewachsen, da ist es doch immer etwas anders. Ich habe die Aufsätze von ihm abgeschrieben. Er trug in der Schule meistens einen braunen Anzug mit Gürtel, der an den Ärmeln blankgewetzt war. Auch war er der einzige von uns, der die große Riesenwelle am Reck* konnte. Das Haar flog ihm wie Seide ins Gesicht, wenn er sie machte. Kantorek war deshalb stolz auf ihn. Aber Zigaretten konnte er nicht vertragen. Seine Haut war sehr weiß, er hatte etwas von einem Mädchen.
Ich blicke auf meine Stiefel. Sie sind groß und klobig, die Hose ist hineingeschoben; wenn man aufsteht, sieht man dick und kräftig in diesen breiten Röhren aus. Aber wenn wir baden gehen und uns ausziehen, haben wir plötzlich wieder schmale Beine und schmale Schultern. Wir sind dann keine Soldaten mehr, sondern beinahe Knaben, man würde auch nicht glauben, dass wir Tornister schleppen können. Es ist ein sonderbarer Augenblick, wenn wir nackt sind; dann sind wir Zivilisten und fühlen uns auch beinahe so.
Franz Kemmerich sah beim Baden klein und schmal aus wie ein Kind. Da liegt er nun, weshalb nur? Man sollte die ganze Welt an diesem Bette vorbeiführen und sagen: Das ist Franz Kemmerich, neunzehneinhalb Jahre alt, er will nicht sterben. Lasst ihn nicht sterben!
Meine Gedanken gehen durcheinander. Diese Luft von Karbol und Brand verschleimt die Lungen, sie ist ein träger Brei, der erstickt.
Es wird dunkel. Kemmerichs Gesicht verbleicht, es hebt sich von den Kissen und ist so blaß, dass es schimmert. Der Mund bewegt sich leise. Ich nähere mich ihm. Er flüstert: »Wenn ihr meine Uhr findet, schickt sie nach Hause.«
Ich widerspreche nicht. Es hat keinen Zweck mehr. Man kann ihn nicht überzeugen. Mir ist elend vor Hilflosigkeit. Diese Stirn mit den eingesunkenen Schläfen, dieser Mund, der nur noch Gebiss ist, diese spitze Nase! Und die dicke weinende Frau zu Hause, an die ich schreiben muss. Wenn ich nur den Brief schon weg hätte.
Lazarettgehilfen gehen herum mit Flaschen und Eimern. Einer kommt heran, wirft Kemmerich einen forschenden Blick zu und entfernt sich wieder. Man sieht, dass er wartet, wahrscheinlich braucht er das Bett.
Ich rücke nahe an Franz heran und spreche, als könnte ihn das retten: »Vielleicht kommst du in das Erholungsheim am Klosterberg, Franz, zwischen den Villen. Du kannst dann vom Fenster aus über die Felder sehen bis zu den beiden Bäumen am Horizont. Es ist jetzt die schönste Zeit, wenn das Korn reift, abends in der Sonne sehen die Felder dann aus wie Perlmutter. Und die Pappelallee am Klosterbach, in dem wir Stichlinge* gefangen haben! Du kannst dir dann wieder ein Aquarium anlegen und Fische züchten, du kannst ausgehen und brauchst niemand zu fragen, und Klavier spielen kannst du sogar auch, wenn du willst.«
Ich beuge mich über sein Gesicht, das im Schatten liegt. Er atmet noch, leise. Sein Gesicht ist nass, er weint. Da habe ich ja schönen Unsinn angerichtet mit meinem dummen Gerede!
»Aber Franz« – ich umfasse seine Schulter und lege mein Gesicht an seins. »Willst du jetzt schlafen?«
Er antwortet nicht. Die Tränen laufen ihm die Backen herunter. Ich möchte sie abwischen, aber mein Taschentuch ist zu schmutzig.
Eine Stunde vergeht. Ich sitze gespannt und beobachte jede seiner Mienen, ob er vielleicht noch etwas sagen möchte. Wenn er doch den Mund auftun und schreien wollte! Aber er weint nur, den Kopf zur Seite gewandt. Er spricht nicht von seiner Mutter und seinen Geschwistern, er sagt nichts, es liegt wohl schon hinter ihm; – er ist jetzt allein mit seinem kleinen neunzehnjährigen Leben und weint, weil es ihn verlässt.
Dies ist der fassungsloseste und schwerste Abschied, den ich je gesehen habe, obwohl es bei Tiedjen auch schlimm war, der nach seiner Mutter brüllte, ein bärenstarker Kerl, und der den Arzt mit aufgerissenen Augen angstvoll mit einem Seitengewehr von seinem Bett fernhielt, bis er zusammenklappte.
Plötzlich stöhnt Kemmerich und fängt an zu röcheln. Ich springe auf, stolpere hinaus und frage: »Wo ist der Arzt? Wo ist der Arzt?«
Als ich den weißen Kittel sehe, halte ich ihn fest.
»Kommen Sie rasch, Franz Kemmerich stirbt sonst.«
Er macht sich los und fragt einen dabeistehenden Lazarettgehilfen: »Was soll das heißen?«
Der sagt: »Bett 26, Oberschenkel amputiert.«
Er schnauzt: »Wie soll ich davon etwas wissen, ich habe heute fünf Beine amputiert«, schiebt mich weg, sagt dem Lazarettgehilfen: »Sehen Sie nach«, und rennt zum Operationssaal.
Ich bebe vor Wut, als ich mit dem Sanitäter gehe. Der Mann sieht mich an und sagt: »Eine Operation nach der andern, seit morgens fünf Uhr – doll, sage ich dir, heute allein wieder sechzehn Abgänge* – deiner ist der siebzehnte. Zwanzig werden sicher noch voll – «
Mir wird schwach, ich kann plötzlich nicht mehr. Ich will nicht mehr schimpfen, es ist sinnlos, ich möchte mich fallen lassen und nie wieder aufstehen.
Wir sind am Bette Kemmerichs. Er ist tot. Das Gesicht ist noch nass von den Tränen. Die Augen stehen halb offen, sie sind gelb wie alte Hornknöpfe. —
Der Sanitäter stößt mich in die Rippen.
»Nimmst du seine Sachen mit?«
Ich nicke.
Er fährt fort: »Wir müssen ihn gleich wegbringen, wir brauchen das Bett. Draußen liegen sie schon auf dem Flur.«
Ich nehme die Sachen und knöpfe Kemmerich die Erkennungsmarke* ab. Der Sanitäter fragt nach dem Soldbuch*. Es ist nicht da.
Ich sage, dass es wohl auf der Schreibstube sein müsse, und gehe. Hinter mir zerren sie Franz schon auf eine Zeltbahn.
Vor der Tür fühle ich wie eine Erlösung das Dunkel und den Wind. Ich atme, so sehr ich es vermag, und spüre die Luft warm und weich wie nie in meinem Gesicht. Gedanken an Mädchen, an blühende Wiesen, an weiße Wolken fliegen mir plötzlich durch den Kopf. Meine Füße bewegen sich in den Stiefeln vorwärts, ich gehe schneller, ich laufe. Soldaten kommen an mir vorüber, ihre Gespräche erregen mich, ohne dass ich sie verstehe. Die Erde ist von Kräften durchflossen, die durch meine Fußsohlen in mich überströmen. Die Nacht knistert elektrisch, die Front gewittert dumpf wie ein Trommelkonzert. Meine Glieder bewegen sich geschmeidig, ich fühle meine Gelenke stark, ich schnaufe und schnaube. Die Nacht lebt, ich lebe. Ich spüre Hunger, einen größeren als nur vom Magen. —
Müller steht vor der Baracke und erwartet mich. Ich gebe ihm die Schuhe. Wir gehen hinein, und er probiert sie an. Sie passen genau. —
Er kramt in seinen Vorräten und bietet mir ein schönes Stück Zervelatwurst an. Dazu gibt es heißen Tee mit Rum.
Aufgaben zum Text
1. Warum ruiniert der Krieg in erster Linie junge Menschen?
2. Beweisen Sie, dass der Unteroffizier Himmelstoß der schärfste Schinder des Kasernenhofes war.
3. Sprechen Sie über die „Ausbildungszeit” der Freunde im Rekrutenlager. Worauf hat sie die Freunde vorbereitet?
4. Beschreiben Sie Franz’ Tod. Warum benimmt sich der Arzt so?
Texterläuterungen
Saul – erster König des Reichs Israel