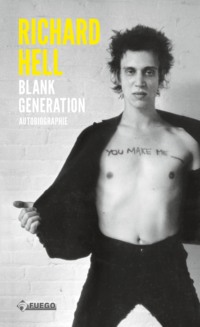
Blank Generation
Es war vermutlich in der sechsten Klasse, als ich zur Hochform auflief. Ich war ein Goldjunge ohne Arroganz. Meine Lehrerin in jenem Jahr, Mrs. Vicars, traf eine Vereinbarung mit mir, die es mir erlaubte, anstatt der üblichen Hausaufgaben Geschichten zu schreiben.
In der siebten Klasse jedoch stürzte ich ab, und es dauerte Jahre, bis ich es wieder nach oben schaffte. Die Babyboomer der Nachkriegszeit hatten das Schulsystem von Lexington eingeholt. Die Schulen waren so überfüllt, dass eine alte große Bruchbude im Stadtzentrum für die Nutzung von Hunderten und Aberhunderten Siebtklässlern aus der ganzen Stadt in Beschlag genommen wurde. In dieser großen Schule mit unbekannten Kindern meines Alters verlor ich jede Vorgeschichte und jedes Ansehen, das ich vorher hatte. Ich war ein Nobody, und bei meinem mangelnden Selbstbewusstsein war es unmöglich, aufzuholen. Alles, woran ich mich aus jenem Schuljahr erinnere, ist Angst und Traurigkeit, verbunden mit qualvollem Neid auf die erfolgreichen Rednecks: der dominierende, reife Gary Leach mit den bis zum Bizeps aufgerollten Ärmeln, eng anliegenden Jeans, kurzem, in präzisen Strähnen gelegtem Haar, der im Schulbus hinter mir der lieblich schluchzenden Susan Atkinson zuflüsterte: »Bei mir kannst du dich ausweinen«; der toughe, schneidige Jimmy Gill, der mit seinen abgebrochen Vorderzähnen Jerry Lee Lewis ähnelte; oder der muskulöse, selbstsichere Farmersohn Hargus Montgomery.
Es gab im letzten Moment eine aussöhnende Erfahrung. Da ich traumatisiert war und mich nichts dazu bringen konnte, irgendwelche Hausaufgaben zu machen, waren meine Noten, die ich mühelos mit Auszeichnung erworben hatte, auf befriedigend, ausreichend und schließlich ungenügend abgerutscht. Noten maß ich keine große Bedeutung bei, aber auf einmal empfand ich es als kränkend, so zu versagen. Doch als uns Ende des Jahres standardisierte »Leistungstests« gegeben wurden, erzielte ich die höchste Punktezahl in der ganzen Schule. Man hätte mir das normalerweise nicht mitgeteilt, aber die Leitung glaubte, mit mir darüber reden zu müssen. Danach bemerkte ich, dass sich die Lehrer mir gegenüber anders verhielten. Ich bekam so etwas wie Glamour. Sie blieben stehen und schauten mich an, wenn ich vorbeiging.
Die Jahre auf der Junior High School – von der siebten bis zur neunten Klasse – waren furchtbar. Wegen der Überbelegung besuchte ich jedes Jahr eine andere Schule mit immer wechselnden, unbekannten Klassenkameraden. Ich hasste Hausaufgaben. Ich litt auch unter Schlaflosigkeit, weil ich immer daran denken musste, nicht vorbereitet und ein Versager zu sein. Alles in der Schule missfiel mir. Selbst wichtige Schularbeiten schob ich bis zum Vorabend der Abgabe hinaus, und dann saß ich schwitzend in meinem Zimmer unterm Dach vor irgendwelchen Texten, die ich paraphrasierte, um einen Aufsatz zusammenzuschustern und aufzupeppen. Ich litt an Schlaflosigkeit, als wäre ich in eine Falle geraten, gelähmt vom Scheinwerferlicht. Ich wusste, es war meine Angst vor dem schlechten Abschneiden und dem Ansehensverlust, die mich wachhielt. Und doch konnte ich mich nicht dazu zwingen, die blöden Hausaufgaben zu machen, und ich fand auch nicht wirklich heraus, was eigentlich los war. Und all das verstärkte sich gegenseitig in meinem Kopf. Es war wie ein ständiges Kribbeln auf der Haut. Als gäbe es eine Droge, die ich dringend brauchte, aber nicht hatte.
Sobald ich meiner selbst bewusst wurde, begann ich die rohe Unterdrückung zu hassen, der man als Kind ausgesetzt war. Ich mag normalerweise keine »Alpha«-Leute, und in den willkürlichen geschlossenen Gemeinschaften von Schulen hat man es ständig mit ihnen zu tun. Ich konnte es einfach nicht ausstehen, mit Fremden zusammengepfercht zu sein. Basta. Auch missfiel mir, gesagt zu bekommen, was ich tun sollte, und natürlich geht es in der Schule und in der Kindheit um die Autorität der Erwachsenen. Ich wusste so gut wie jeder von ihnen, was lohnenswert war, aber weil ich ein Kind war und sie größer waren und mehr Macht hatten als ich, wurde ich betrogen.
Ich erinnere mich, dass ich noch als Kind meinem erwachsenen Selbst ein Versprechen abverlangte. Ich gelobte, nicht zu vergessen, wie willkürlich und unfair die Regeln der Erwachsenen sind. Ich gelobte, den Prinzipien treu zu bleiben, die, wie ich bald begriff, die Erwachsenen manchmal vorgaben zu kennen, aber an die sie sich kaum hielten.
Ich wollte ein Leben voller Abenteuer haben. Ich wollte nicht, dass mir irgendjemand sagte, was ich zu tun hatte. Ich wusste, dass dies das Wichtigste war und dass alles verloren wäre, wenn ich mich verlogen verhielte, so wie es die Erwachsenen taten.
Die monströsen, kastenförmigen, breitschnäuzigen, eigelbfarbenen Schulbusse mit ihrer schwarzen Beschriftung waren für mich Symbole der Einsamkeit und Demütigung. Sie rollten durch graues und regnerisches Wetter, und ich starrte aus dem Fenster in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden außer von einem ganz besonderen Mädchen.
Kapitel Zwei
Vor einiger Zeit saß im Kino ein hübsches Mädchen vor meiner Frau und mir, und alles, was ich von ihr sehen konnte, war ihr Haar. Als ich in der Grundschule im Klassenzimmer hinter Mädchen saß, konnte ihr Haar mich zum Wahnsinn treiben. Es war nicht einmal wirklich lebendig, aber ergreifender als die Gesichter der meisten Menschen wegen der Intimität, mit der es mit seiner Trägerin in Verbindung stand. Es war unerreichbar, während es direkt vor mir war, völlig entblößt, mit all seinen unkontrollierten, wilden Implikationen und Botschaften seiner Pflege, und ich empfand es als herzzerreißend, dass seine Besitzerin nichts von seiner Wirkung ahnte. Es war, als beobachtete man heimlich einen schlafenden Menschen.
In der dritten Klasse war ich verrückt nach Mimi McClellan. Wenn ich versuche, mir ein Bild von ihr zu machen, so ist da kein Gesicht. Nur ihr hoch toupiertes dunkelblondes Haar. Aber wenn ich es mir überlege, dann gab es damals niemanden, der in dem Alter die Haare toupierte. Es war das Jahr 1958, auch die Frauen trugen noch nicht eine solche Frisur, bis zwei oder drei Jahre später Jackie Kennedy ihren Auftritt hatte. Nachts lag ich in meinem Bett, dachte an Mimi McClellan und phantasierte, ich würde von einem Auto angefahren, so dass sie meine Hand nehmen würde und ich ihr sagen könnte, dass ich sie liebe.
In der sechsten Klasse war es Janet Adelstein. Es ist wahrscheinlich Janets Haar, das ich Mimi zuschrieb. Denn Janet hatte eine von Haarspray konservierte, dunkelblonde Hochfrisur, von der ein seidiger, wohlduftender Hauch ausging.
Die jungen Mädchen trugen weiße Baumwollblusen mit Ringelkragen, Strickjacken und Hosenröcke. Vielleicht noch eine zierliche Halskette aus Gold, Tennisschuhe oder Bass Slipper und Söckchen. Viele der Mädchen in der Klasse hatten schon Brüste. Janets Brüste waren größer als die der meisten anderen.

Verrückt nach Mimi McClellan.
© by Richard Meyers, mit freundlicher Genehmigung der Fales Library and Special Collections, New York University Libraries
Ich offenbarte ihr nie meine Gefühle für sie. Jahre später trafen wir uns irgendwo zufällig, unterhielten uns, und es stellte sich heraus, dass auch sie damals in mich verknallt war. Irgendwie tragisch, geradezu Shakespearhaft.
Ich weiß nicht mehr, wann ich zu onanieren anfing, aber es war lange, bevor ich ejakulieren konnte. Wir Jungen glaubten, Wichsen oder Sex zu haben sei etwas Perverses und Schlechtes. Ich hatte die Taktik, mich damit zu entschuldigen, dass ich einen Ständer nicht durch tatsächliches Berühren des Penis kriegte, sondern durch die bloße Vorstellungskraft. Denke ich heute an diese Phantasien, dann würde ich sie gerne sehen können, als ob sie Filme wären – ich hatte so wenig Ahnung von Sex, da wäre es cool zu sehen, was mir durch den Kopf ging (ich weiß noch, dass Roy Bakers Mutter manchmal dabei eine Rolle spielte).
Zu der Zeit, da ich dreizehn war, war das Wenige, was ich über die sexuelle Mechanik wusste, eine Menge. Schon ein Bild malen mit wenigen Details wie ein Unendlichkeitszeichen mit einem Punkt in der Mitte beider Schleifen und darunter die Umrisse eines Stundenglases, das in der unteren Hälfte ein gekritzeltes, abwärts zeigendes Dreieck hatte, reichte schon, um bei einem Jungen eine gewaltige Erektion hervorzurufen. Am Anfang der achten Klasse achtete ich beim Laufen monatelang darauf, meine Schulbücher vor meine Jeans zu halten, um die Beule zu verbergen. Manchmal entkamen nur durch die Reibung am Stoff ein paar Tropfen Flüssigkeit, und einmal stand ich auf dem vollen Schulkorridor und hatte eine Ejakulation.
Als es mir mit dreizehn oder vierzehn endlich gelang, einen Finger in eine Vagina zu stecken, hatte ich das Gefühl, in eine neue, fast übernatürliche Dimension eingeweiht zu werden, als hätte ich das Schwert aus dem Stein gezogen. Danach machte ich einen langen Spaziergang und hielt alle paar hundert Meter meine Finger unter die Nase – das Duftabzeichen meines neuen Königreichs.
Ich hatte keinen richtigen Sex, bis ich fünfzehn war. Ich war an ihr nur interessiert, weil ich glaubte, sie werde mich vielleicht ranlassen. Der Sexualtrieb überwältigt fast alles. Viele sind beim Ficken gestorben. Woher kommt denn schließlich rücksichtslose Aggression, wenn nicht vom Testosteron? Und woher kommt dieses Testosteron? Dieses unglückliche Mädchen jedoch mochte Sex ganz und gar nicht, und auch sonst kaum etwas, soweit ich das feststellen konnte. Sie arbeitete als Bedienung in einem Autokino in der Nähe der Universität. Sie war neunzehn und ein Landei aus den Appalachen; sie war nicht nur engstirnig und ungebildet, sondern auch dumm wie Stroh und fast genauso lebhaft. Jedes Mal, wenn ich mir dort einen Hamburger kaufte, flirtete ich mit ihr. Ich erzählte ihr, ich sei Medizinstudent im ersten Semester. Ich begleitete sie von der Arbeit nach Hause. Bald gab sie mir den Schlüssel zu ihrem Apartment.
Der Sex mit ihr war nicht entspannt. Es war, als müsste ich mich durch wildes Gebüsch hacken, das sich an meine Fußknöchel klammerte und das Gesicht zerkratzte, während ich mich vorwärtskämpfte, mit rasendem Herzen, weil der Antrieb so mächtig war, auf weibliche Genitalien, auf eine triefend nasse Muschi. Am Ende war ihre Muschi nicht besonders feucht, denn sie war nervös und gehemmt. Es war schrecklich, sie zu ficken, auch wenn ich nicht genug davon bekommen konnte. Selbst als endlich ihre Klamotten weg waren und sie unter mir auf dem Bett lag, machte sie nicht mit, sondern widersetzte sich, um den Schein zu wahren, und während der Penetration gab sie sich völlig unbeteiligt, lag stoisch da und vollführte ein oder zwei ablehnende Hüftstöße. Damit wollte sie kundtun, dass sie keine verruchte Person war, sondern diesen peinlichen, scheußlichen Akt nur mir zu liebe als einen widerwillig gewährten Gefallen zuließ.
Es soll immer noch Gesellschaftsschichten geben, wo ein solches Verhalten selbst zwischen verheirateten Paaren üblich ist. Was großartig für die Pornographie ist. Und für die sexuelle Revolution und die Pille und für rebellische, lebenslustige Frauen. Allerdings kann ich es nicht leugnen, dass ich immer noch verklemmt und Amerikanisch genug bin, um schmutzigen Sex zu mögen. Und ich liebe Haare. Weil sie tot und doch etwas Persönliches sind und weil ich gerührt bin von ihrem vergeblichen Bemühen, die Stellen, wo sie wachsen, zu wärmen und zu schützen.
Kapitel Drei
So linkisch und seltsam ich auch seit dem zwölften Lebensjahr war, immer noch fühlte ich mich als romantischer Held und wollte unbedingt eine Versöhnung zwischen meinem Inneren und Äußeren, selbst wenn das Ergebnis grotesk war. Als Kind phantasierte ich manchmal ein Leben als bettlägeriger fettleibiger Einsiedler, der wie eine Spinne in ihrem Netz mit der ganzen Welt fertig wird, empfindlich für jedes Zittern und sofort darauf reagierend. So jemand wie ein verschwenderischer Orson Welles oder verrückter Howard Hughes, ein ruheloser Superman. Ich hielt mich für faszinierend und charmant, wagte aber klugerweise nicht, es in Gesellschaft zu testen.
In der neunten Klasse geriet ich häufiger in kleine Konflikte mit den Autoritäten. Einmal benutzte ich Substanzen aus einem alten Chemie-Baukasten, um in meinem Schulbus eine Explosion herbeizuführen. Es war nur Lärm und Rauch, aber ich hatte meinen Spaß. Dafür erhielt ich drei Tage Schulverbot.
Einige Zeit später legte ich eine Packung Feuerwerkskörper in ein Schließfach auf dem Schulkorridor und brachte sie mit einer brennenden Zigarette zur Explosion. Im Metallschrank gab es ein lautes Krachen. Meine Klassenlehrerin stürzte nach draußen und kam keuchend zurück: »Die Uhr ist explodiert!« Ich konnte nicht aufhören zu lachen, was mich wohl verriet. Diesmal wurde ich für drei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen.
Dann bekam ich völlig überraschend ein Stipendium für Sayre, die einzige Privatschule in der Stadt. Mein Biologielehrer aus der siebten Klasse war dorthin gewechselt, und die Schule hatte mit einem Stipendienprogramm für zwei Schüler begonnen. Meine Mutter erhielt einen Telefonanruf mit dem Angebot, für mich das volle Schulgeld zu bezahlen.
Larry Flynn, der andere Stipendiat, wurde mein bester Freund. Er hatte Leichtathletik als Schwerpunkt, ich sollte mich auf wissenschaftliche Fächer konzentrieren. Er wurde der Quarterback des bunt zusammengewürfelten Footballteams und der Star im Basketball, während meine Noten schlecht blieben, aber uns beiden gefiel die neue Situation. Die reichen Mädchen waren inspirierend. Diese schlanken süß riechenden blassen sommersprossigen Körper, eingewickelt in Kaschmir und in ägyptischer Baumwolle. Die Girls auf der Privatschule waren rauer und in mancher Hinsicht sexier, aber für jemanden wie mich war es schwer, aus ihnen schlau zu werden. (In der achten Klasse, als sich die erste Chance ergab, Sex mit einem Mädchen zu haben – ein armes Arbeiterkind aus der Schule und eine Jungfrau wie ich –, hörte ich irgendwann auf, weil es sie zu schmerzen schien. Schnell fand sie einen weniger rücksichtsvollen Typ.) Ich war glücklich an einer so kleinen Schule wie Sayre, wo jeder jeden kannte. Allerdings bekam ich auch dort Ärger.
In meinem Viertel konnte man damals innerhalb kurzer Zeit ein Auto mit dem Schlüssel im Zündschloss finden. Ich borgte sie mir für Spritztouren mit Freunden und versuchte dabei, das Fahren zu lernen, wobei ich nicht vergaß, den Wagen zurückzubringen, bevor er vermisst wurde. Spät abends schlich ich aus dem Haus, und manchmal nahm ich auch den Wagen meiner Mutter oder der Eltern meiner Freunde. Ich glaube, mit denen ging ich rücksichtsloser um. Zweimal wurde ich dabei erwischt. Das erste Mal, als ich die Wagenschlüssel meiner Mutter klaute.

Im Sayre Basketball-Team, 1965 - neben mir: Larry Flynn.
© mit freundlicher Genehmigung von Richard Meyers
Nachdem es endlos lange gedauert hatte, von meinem Zimmer auf Zehenspitzen die knarrende Treppe runterzuschleichen, ging es durch die Haustür hinaus in die großartige Nacht. Draußen war es wegen des Vollmondes und der Sterne heller als im Haus, es war kühl, das funkelnde graue Gras und das Auto feucht vom Abendtau. Freunde warteten bereits auf mich. Wir schalteten in den Leerlauf, schoben das Auto aus der Auffahrt und rollten es den Hügel hinunter, bevor wir den Motor kommen ließen und losfuhren.
Wir beschlossen, uns nach Cincinnati aufzumachen, etwa 150 Kilometer Richtung Norden. Auf der vierspurigen Autobahn zu fahren, war wie ein Rennen durch den Gang eines leeren riesigen Supermarkts. Große Schilder, die alle möglichen Optionen ankündigten, flitzten an der Windschutzscheibe vorbei. Wir lachten und tranken und rauchten. Das unausgesprochene Risiko, einen Unfall zu bauen, erhöhte noch den Nervenkitzel. Ich hatte ganz sicher nicht alles im Griff. Als wir endlich Cincinnati erreichten, wusste keiner von uns, was wir dort machen sollten, also kehrten wir um.
Wieder in Lexington, beschlossen wir, das Viertel der Schwarzen unter dem Viadukt zu erkunden. Ich verfuhr mich in den schlecht beleuchteten, halbgepflasterten Straßen und bei dem Versuch, aus einer Sackgasse herauszukommen, rammte ich einen Mast und würgte den Motor ab. Als ich ihn wieder anließ, hatte das Auto eine Fehlzündung und beschleunigte unkontrollierbar. Schon eine Minute später rasten wir durch die Stadtmitte. Ich hatte Angst, die Bremsen zu benutzen, weil ich glaubte, das könnte das Auto völlig ruinieren. Also schaltete ich die Zündung aus. Als das Auto im Leerlauf ein vernünftiges Tempo erreichte, startete ich den Motor erneut, wieder gab es eine Fehlzündung, und mit Vollgas ging es weiter. Ziemlich schnell erregte dieses Stop-and-Start Dragsterrennen die Aufmerksamkeit der Polizei, und zwei oder drei Streifenwagen tauchten hinter uns auf. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt von vielleicht einem Kilometer trat ich auf die Bremse, wir sprangen aus dem Wagen und rannten weg. Sie jagten uns mit Hunden und schnappten uns.
Bei dem zweiten Vorfall war Leslie Woolfolk beteiligt. Sie war ein blasses, spindeldürres Mädchen, das sich mit einer Gruppe freiwilliger Außenseiterinnen von Sayre herumtrieb. Sie verhöhnten alles und waren wie eine wilde Herde kleinwüchsiger Giraffen mit hübschen, flachen Kätzchengesichtern. Ich mochte sie alle.
Sie war einverstanden, sich mit mir um Mitternacht mit den Autoschlüsseln ihrer Eltern zu treffen. Wir wollten aufs Land nahe der Stadt Versailles fahren, wo ein weiteres Giraffenmädchen auf einer Pferdefarm lebte. Das Auto ihrer Eltern hatte allerdings eine Handschaltung, und das war neu für mich. Wir schafften es bis zur Farm, aber als ich in der Dunkelheit rückwärts aus einer falschen Einfahrt fuhr, vergaloppierte ich mich und blieb hoffnungslos in einem Graben stecken.
Wir verbrachten die kalte Nacht in einer Heuhütte und wärmten uns gegenseitig; leider zog sie die Grenze für Berührungen frustrierend eng. Wir malten uns aus, dass wir den Wagen am nächsten Morgen von einem Traktor herausziehen lassen und dann nach Florida flüchten würden. Im Morgengrauen, als wir wieder im Wagen saßen, klopfte ein Polizist an die Scheibe.
Die Schule drohte mit Ausschluss. Das verstand ich nicht, denn die Sache hatte ja nichts mit der Schule zu tun. Unsere freundlichen Mitschüler jedenfalls protestierten mit einer Petition und der Direktor lenkte ein. Wir wurden beide für zwei Wochen suspendiert.
Als Strafe für das erneute Schulverbot befahl mir meine Mutter, die Holzfassade unseres Hauses zu streichen – die Fenster- und Türrahmen und die Paneelen unter den Dachrinnen. Immerhin erlaubte sie mir, Musik zu hören. Ich hatte einen kleinen tragbaren Plattenspieler mit einem Verlängerungskabel. Ich besaß nur drei LPs: The Rolling Stones, Now!; Bringing It All Back Home von Bob Dylan und Kinks-Size (mit »All Day and All of the Night« und »Tired of Waiting for You«) von den Kinks. Ich spielte sie wieder und wieder, während ich in der Sonne auf der Leiter stand und das Holz anstrich. Die Stones-Platte begann, sich zu wellen. Ich legte sie zwischen zwei Bratpfannen in den heißen Ofen, und am nächsten Tag klang sie sogar noch besser.
Man mag es kaum glauben, doch sieben oder acht Jahre später, als ich selbst eine Band gründete, traf auf diese drei Platten, die ersten, die mir gehörten und die eine Zeitlang meine einzigen waren, immer noch zu, was mich an Musik begeisterte – die Stücke waren schnell, aggressiv und höhnisch, aber komplex und voller Gefühle. Im Jahr 1965 waren sie nur der beiläufige Soundtrack zum Zeit totschlagen; sie bedeuteten mir nicht viel mehr als die Frage, was für ein Hemd jemand trug oder was für ein Fremder neben mir im Bus saß. Klar, wenn ich damals darüber nachgedacht hätte, was ich da hörte, hätte ich gesagt, ich wollte das Leben dieser Jungs haben, die solche Platten machten, bzw. das Leben, das diese Jungs meiner Vorstellung nach hatten, aber ich hielt die Musik einfach für selbstverständlich. Die Musik war alles, was ich wollte – sie erfüllte mich mit Selbstvertrauen und Unruhe und dem Gefühl, ein besonderes Wissen und einen besonderen Sexappeal zu haben, aber ich nahm sie als gegeben hin. Und ich glaubte, ich könnte sie unter den richtigen Umständen selbst machen. Allerdings glaubte ich nicht, dass ich es je versuchen würde. Ich wusste aus Erfahrung, dass das Üben auf einem Instrument langweilig war (ich hatte etwa ein Jahr lang Klarinettenunterricht), und es schien sehr unwahrscheinlich zu sein, ja sogar unvorstellbar, dass jemand, den ich kannte, (nämlich ich) je Platten machen würde.
Kapitel Vier
Eines Tages, auf mir lag der Schatten meiner Teenager-Vergehen, fuhr mich meine Mutter schweigend durch den Verkehr zu einem Einkaufszentrum. Ich saß auf dem großen Vordersitz des ‘55 Buick, der den Kaiser ersetzt hatte. Wortlos hielt sie plötzlich am Straßenrand an und schlug immer wieder heftig ihren Kopf gegen das Lenkrad. Von ihrer Stirn rann Blut. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Es war wahrscheinlich mein letztes Missgeschick in Lexington, das zu der verzweifelten Reaktion meiner Mutter führte. Rebecca, die Kellnerin bei Big Boy, mit der ich als Fünfzehnjähriger den ganzen Sommer verbrachte, war eines Abends früher von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte mich trinkend mit ein paar Mädchen in ihrem Apartment erwischt. Aus Rache rief sie meine Mutter an und behauptete, von mir schwanger zu sein. Sie rief auch den Leiter der Englischabteilung an der Universität an, wo meine Mutter studierte.
Zu dieser Zeit schloss meine Mutter ihre Doktorarbeit ab und bekam eine Stelle als Dozentin für Amerikanische Literatur am Old Dominion, einer staatlichen Universität in Norfolk (Virginia). Dorthin fuhren wir im Sommer 1965 in unserem ersten nagelneuen Wagen, einen roten kleinen Chevy Corvair, den Onkel Dick und Tante Phyllis ihr zur Promotion geschenkt hatten. Wir zogen in ein Apartment im zweiten Stock eines alten zweistöckigen Hauses an der Jamestown Crescent, der Hauptavenue von Larchmont, einem ruhigen, baumbeschatteten Wohnviertel aus den zwanziger Jahren. Das College lag ganz in der Nähe.
Norfolk war ein Nicht-Ort. Dagegen sah selbst Lexington elegant aus. Sein Herz war eine riesige Marinebasis, die größte der Welt, und der Rest der Stadt war eine genaue Entsprechung dieser Trostlosigkeit in Stahl und Beton. Alle Standorte waren durch kleine Tunnel und Brücken über einem Netzwerk verschmutzter Buchten und Wasserstraßen miteinander verbunden. Es gab nur noch wenige Backsteinzeugnisse eines alten Virginia, das mindestens so konservativ war wie das anonyme Militär. Selbst Virginia Beach, die zwanzig Meilen entfernte Atlantikküste, derentwegen meine Mutter den Job überhaupt attraktiv fand, war hässlich: eine schäbige Ansammlung protziger Mittelklassehotels oder schmuddeliger Billigpensionen, umgeben von Reklameschildern, T-Shirt- und Souvenirläden, Fast-Food-Ketten und aneinandergereihter öder Strandhäuser.
Ich wurde für die elfte Klasse in einer riesigen öffentlichen High School angemeldet. Ich war nie fähig gewesen zu lernen, und ich wusste, ich würde wieder sozial nicht dazugehören. Ich hätte lieber ein Zimmer allein in einer billigen Pension irgendwo in den USA gehabt als Schulbücher durch diese scheußlichen Korridore zu tragen.
Nach einigen Wochen der Drohungen und Versprechungen erklärte sich Mutter schließlich bereit, für mich eine Schule wie Sayre zu suchen. Meine Vorgeschichte war ein Problem – nicht nur die Ausschlüsse, auch meine Noten, die gerade mal befriedigend und ausreichend waren, obwohl ich ein Stipendium für Sayre bekommen hatte. Und wir hatten kein Geld. Meine Mutter besprach die Lage mit Grandma Linda. Sie suchten ein wenig und fanden schließlich ein gemischtes Internat in Delaware, das mich akzeptierte. Großmutter gab meiner Mutter einen Großteil des Schulgelds.
Sanford Preparatory School lag etwa achtzig Meilen nordwestlich von Wilmington inmitten von 50 Hektar Feldern und bewaldeten Hügeln. Die meisten der auf sechs Klassen verteilten 165 Schüler wohnten dort. Es gab sechs kleine, nach Geschlechtern getrennte Wohnheime. Einige davon waren umgebaute Farmgebäude, die anderen eine neu errichtete Art von Barracken. Die Klassenzimmer befanden sich in früheren Farmhäusern, und es gab eine moderne Bücherei mit großen Fensterscheiben, die das Innere besonders an Schneetagen behaglich machten. Die Schule hatte ein nagelneues »Fieldhouse« (Sporthalle) sowie Tennisplätze und Felder für Hockey, Baseball, Football und Lacrosse und sogar einen kleinen Stall. Die Jungen trugen Sportsakkos – wahlweise Schulblazer – und Krawatten, und die Mädchen Kniestrümpfe und Schottenröcke und über ihre weißen Baumwollblusen Blazer oder Strickjacken.

