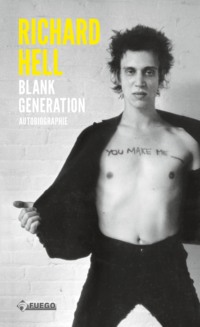
Blank Generation
Aber wenn ich jetzt auf das Gedicht schaue, gibt es mir einen Kick, und ich kann es ohne Zwang, eine Bedeutung darin zu entdecken, lesen und verstehen, dass gerade das einen Großteil des Vergnügens ausmacht. Wenn man jene Strophe liest, als wäre es Alltagsrede, ähnelt sie einem Spiegelkabinett, das einen mit seinen jähen Wendungen, den vorbeiziehenden Szenen und den Sprüngen zwischen den Ebenen überrascht. Der Text ist krude, zwingt nicht passende Sätze zusammen, und in dieser Hinsicht ist er liebenswert unprätentiös. Er kam der Methode der Zufallsmontage schon ziemlich nahe. Und immerhin verwendete selbst Ted Berrigan, mein liebster New Yorker Dichter, in The Sonnets wiederholt Anspielungen auf Dylan Thomas.
Ich war als Siebzehnjähriger der Lyrik von Thomas verfallen, und ich besorgte mir auch einen Band mit seinen Briefen und eine Biographie. Dylan Thomas sah aus wie ein würdevolles Schweinchen mit einer Kippe zwischen den Lippen, wirren Locken und einer nachlässig gebundenen Fliege. Man konnte sehen, dass eine starke innere Haltung nötig war, um sein knolliges Gesicht so sexy zu machen, wie es ihm gelang, und außer seiner eigenwilligen Art, mit der Sprache umzugehen, bedurfte es einer Menge Alkohol und eines guten Sinns für Humor.
Ich ging damals in die Bibliothek, um zu sehen, wer die anderen modernen Dichter waren. Mir missfielen die gebildeten, pingeligen, grimmigen Lyrikproduzenten wie etwa Robert Lowell. Ich entdeckte William Carlos Williams, und mir wurde klar, dass Lyrik für mich genau das Richtige war. Williams hatte ein schönes Buch nach dem anderen im Verlag New Directions veröffentlicht und wurde wie ein VIP behandelt. Ich wusste, dass ich besser schreiben konnte als er. Ich dachte, wenn er es mit ein paar weißen Hühnern, einer regennassen roten Schubkarre und kalten Pflaumen im Eisschrank zu Ruhm bringen konnte, dann könnte ich es auch schaffen. Dylan Thomas war mein Vorbild, aber es war Williams, der mich meine Berufung erkennen ließ. Komisch, auch wenn ich nie viel Interesse an Williams entwickelte, sind seine Objekte fraglos die Highlights dieses Abschnitts. Objektivismus nannte man damals.
Kapitel Sechs
Einen Tag nach Weihnachten 1966 bestieg ich den Bus nach New York. Vier oder fünf Jungs von Sanford machten Ferien in der Stadt. Ich teilte mir mit zwei von ihnen ein Hotelzimmer in der Nähe des Washington Square Park. Wir kauften auf der Straße schlechtes Gras und tranken, und dann, als sie zur Schule zurückkehrten, war ich allein und fast pleite. Ich suchte in den Kleinanzeigen nach einem Job, und schon am nächsten Tag arbeitete ich als Regalauffüller im Kaufhaus Macy’s. Ein junger puertorikanischer Kollege mit großer Afrofrisur war bereit, mich als Mitbewohner aufzunehmen. Ich zog aus meinem Billighotel aus und in sein winziges möbliertes Zimmer am Irving Place 1, Ecke Fourteenth Street ein. Dort gab es ein Bett und einen Schrank, einen kleinen Tisch und eine Spüle. Das Klo war auf dem Flur. Die Miete betrug 20 Dollar die Woche, was wir uns teilten.
Wir wohnten über einer Horn and Hardart-Filiale – ein Automatenrestaurant, wo man auch Pastetenstücke, Makkaroni und frittierte Fischfilets kaufen konnte, die aus kleinen Fenstern gereicht wurden. Einen Abräumservice gab es nur sporadisch, also konnten wir uns vollschlagen, indem wir uns an einen Tisch setzten, der gerade freigeworden war, und das essen, was übrig geblieben war. Mein Zimmergenosse nannte sich einen klassischen Komponisten. Er hatte einige zerknitterte leere Notenblätter, vor denen er manchmal saß und die er anstarrte, während er hin und wieder einige Noten auf die Linien schrieb. Er trank viel. Wir mussten das Bett teilen, und oft kam er mitten in der Nacht betrunken zurück, ließ sich aufs Bett fallen und übergab sich. Es war eine kleine Operette für sich.
Nach ein paar Monaten hatte ich genug gespart, um mir ein Apartment zu besorgen. Von da an hatte ich immer neue Jobs und wechselte ständig die Wohnung. Beides war so reichlich vorhanden, dass es für mich keinen Grund gab, einen Job zu behalten, wenn ich genug verdient hatte, um zwei Wochen ohne Arbeit zu verbringen, und es gab keinen Grund, die Miete zu bezahlen, wenn mein Einkommen zu niedrig war, da erst einige Monate vergehen mussten, in denen man keine Miete gezahlt hatte, bevor der Vermieter einen rechtmäßig rauswerfen konnte. Alle meine Apartments waren klein, die meisten waren dunkel, und einige ein wenig gefährlich. An sieben Behausungen zwischen 1967 und 1975 kann ich mich noch erinnern, und ich weiß noch, als was ich in jenem ersten Jahr arbeitete: Regalauffüller bei Macy’s, Haustürverkäufer für Zeitschriftenabonnements, Regalauffüller in einer Buchhandlung und Hilfsbibliothekar in der Hauptstelle der New York Public Library in der Fifth Avenue, und ich bin sicher, es waren noch mehr Jobs. Später fuhr ich Taxi, machte eine Menge ungelernter Bürotätigkeiten im Auftrag einer Zeitarbeitsfirma, sortierte Briefe in einem Postamt, lud nachts am Hafen in Crews Obst- und Gemüsekisten ab und schleppte als Bauarbeiter fünfzig Pfund schwere Zementsäcke auf Mietshausdächer.
Bei einem dieser Bauarbeiterjobs sah mich Allen Ginsberg. Ihm gefiel mein Aussehen, und er lud mich zu sich ein. Das erinnerte mich an Walt Whitman, der die schweißglänzenden Oberkörper von Arbeitern bewunderte. Ich lehnte seine Einladung ohne zu zögern ab, da mich seine Arbeiten nicht interessierten und ich keine engere Beziehung zu Ginsberg fühlte, und außerdem wollte ich keinen schwulen Typen zu ermutigen, mich anzumachen, auch wenn es mich nicht störte.
Kellnern war ein Job, der für mich nie in Frage kam. Ich hätte es nicht gekonnt, Gäste anzulächeln und wegen Trinkgelder höflich zu sein.
Wenn man es ertragen konnte, irgendwo für das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von fünf Monaten zu arbeiten, dann versuchte man, es so hinzukriegen, dass die Entlassung als unverschuldet und unvermeidlich erschien, denn dann bekam man Arbeitslosigkeitsschecks.
Es gab Wege, sich für öde Jobs zu entschädigen: kleine Diebstähle vor allem, aber meine große Erleuchtung war die Strategie, die ersten drei Wochen so brauchbar und fleißig zu sein, dass ich unverzichtbar erschien, und dann konnte ich monatelang faulenzen, bevor der erste Eindruck nachließ. Wenn ich Glück hatte, dann wurde mir so viel Respekt entgegengebracht, dass ich glaubhaft versichern konnte, persönliche Probleme würden meine Leistung untergraben, bevor der Boss mich entließ. So konnte ich wieder das Arbeitslosengeld einstreichen.
Ich hatte als ignoranter Teenager einige Schreibversuche unternommen, aber ohne irgendein reales Fundament von Werten außer dem niedrigsten, nämlich mein armes, einsames, sentimentales, grandioses, poetisches Selbst ausdrücken zu wollen. Ich vertraute auf meine Einsichten in Situationen und Menschen und auch auf mein elementares ästhetisches Urteilsvermögen. Aber für eine ganze Weile (was in diesem Alter drei oder vier Jahre waren) war ich nur ein Schriftsteller, weil ich mich selbst für einen solchen hielt. Ich schrieb nicht sehr viel, und was ich schrieb, war nicht gut. Das meiste ahmte Dylan Thomas nach (eines meiner frühesten New Yorker Gedichte begann »Rain me green on stones unseething«). Viele Gedichte handelten von dem Verlangen, sich aufzulösen, und von Sex (artifiziell oder unter der Tarnung von Symbolen und Gleichnissen) und von einer Angst vor irgendeiner grässlichen Schwäche in mir selbst. Als Dichter oder Schriftsteller konnte ich als Beispiel dafür dienen, wie eine Maske, die du lange genug trägst, zu deinem Gesicht wird, oder, um es freundlicher zu sagen, wie eine Berufung als Pose beginnt.
Ich schrieb mich für einen Lyrik-Workshop an der New School ein in der Hoffnung, vielleicht Leute zu treffen, die an einigen der gleichen Themen interessiert waren wie ich. Ich hatte Pech mit der Klasse, traf aber ein trauriges, hysterisches Mädchen mit roten Kapillaren in der Nase und Wangenknochen und großen Brüsten, die aussahen wie Eeyore (der Esel aus Winnie the Pooh). Sie ließ mich Sex mit ihr haben.
Der Typ, der die Klasse unterrichtete, war ein ehemaliger Dichter namens José Garcia Villa. »Ehemalig«, weil es zu seiner Selbstdramatisierung gehörte, Ende der fünfziger Jahre mit dem Schreiben aufgehört zu haben, um sich »nicht zu wiederholen«. Er war ein Filipino, geboren 1908 in Manila, lebte aber, seit er einundzwanzig war, meistens in New York. Er erregte ein wenig literarisches Aufsehen in den vierziger und frühen fünfziger Jahren.
Sein poetisches Vokabular war nicht weit entfernt von Dylan Thomas’, enthielt vielleicht auch ein wenig von Blake und Rilke und favorisierte Worte wie »naked« und »bright« und »rose« und »lion« – aber besonders und höchst verräterisch »I« und »God« (über deren beider Wege er seine Leser gerne instruierte) – in sauberen aphoristischen Zeilen.
Jedenfalls veranstaltete er die Workshops nicht zuletzt deswegen, um über einen Zirkel zu präsidieren. Neben dem wöchentlichen Unterricht an der Schule in der West Twelfth Street gab es samstags ein geselliges Treffen in seinem Apartment und ein weiteres jeden Dienstag in einer Smith’s Bar in der Sixth Avenue, Ecke Fourteenth Street. Jeder der Teilnehmer bemühte sich, so lässig arrogant und sexuell provozierend zu sein und so sarkastisch über Dichter geringerer Sensibilität zu urteilen wie er. Ich war der jüngste Student. Villa verkündete allen, ich sei »der am poetischsten Aussehende« und einer der »Kränksten, was eine Voraussetzung für das Verfassen anständiger Gedichte ist«.
Welche Richtung auch immer ich nehmen würde, ich wollte in Bewegung bleiben, und so begann ich, noch bevor 1967 vorbei war, ein Lyrikmagazin zusammen mit einem anderen Studenten aus der Gruppe namens David Giannini herauszugeben. Giannini war etwa so alt wie ich, war vor kurzem aus New Jersey in die Stadt gekommen und war lyrikbesessen. Er sah mehr skandinavisch als italienisch aus – groß und muskulös, dünnes blondes Haar. Er trug eine Brille mit Drahtgestell, ein Arbeitshemd, Cordjeans und Hush Puppies. Er trieb Sport, um in Form zu bleiben, und hatte einige pummelige, aber durchaus sexy Langzeitfreundinnen, die wir oft sahen und die seit der High School in seine poetische Begabung und seine Sexspäße vernarrt waren. Wie Villa liebte er es auch, aphoristisch zu reden, und glänzte mit fragwürdigen Bemerkungen wie »Picassos Nackte habe ihre blaue Periode«.
Getreu unserer lyrischen Neigung nannten wir das Magazin Genesis : Grasp. Die sechs Ausgaben, die wir über vier Jahre (1968-71) veröffentlichten, präsentierten einen Anfang, der eher einer Totgeburt glich. Die ersten drei Nummern waren selbstgefällig, unkoordiniert und amateurhaft wie das Literaturblatt einer High School. Um dem Magazin Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, es hatte sich bis zur letzten Nummer, einer Doppelausgabe (#5/6), sehr verbessert. Aber inzwischen hatte ich mich schon in Anspruch und Einstellung weit von meinem Mitherausgeber entfernt, und ich gab die letzten drei Nummern größtenteils allein heraus. Ich druckte sie auf einer gebrauchten, kleinen Wachsmatritzendruckmaschine in meinem Apartment und machte den Schriftsatz auf einer gemieteten IBM VariTyper.
Ich hatte in jenen Jahren eine weitere bescheidene öffentliche Existenz als Dichter. Als wir mit dem Magazin begannen und ich eine Reihe von Gedichten geschrieben hatte, schickte ich einige an James Laughlin, Verleger von New Directions Books, und fragte, ob sie für das nächste Annual des Verlags in Frage kämen. Meiner Meinung nach war Laughlins Verlag damals der angesehenste in Amerika. Nicht nur war er Dylan Thomas’ amerikanischer Verleger, sondern er veröffentlichte auch Céline, Nabokov, Wilfried Owen und Rimbaud (ganz zu schweigen von Henry Miller, William Carlos Williams und Ezra Pound) und viele andere der literarisch ehrgeizigsten und kühnsten internationalen Schriftsteller. Das Annual war eine Hardcover-Anthologie neuer Arbeiten, die seit Mitte der dreißiger Jahre erschien. In der Ausgabe von 1970 veröffentlichte Laughlin acht meiner Gedichte, die ich in den Vorjahren geschrieben hatte, als ich achtzehn und neunzehn war. Sie waren schrecklich – gestelzt, bombastisch und sentimental. Vier weitere Gedichte erschienen in dem folgenden Jahrbuch, einige waren geringfügig besser. Aber je besser ich wurde, desto weniger schien ihm zu gefallen, was ich tat. Doch noch hielt ich New Directions für meinen Verlag. Laughlin bestärkte mich in dem Glauben, dass er eines Tages ein Buch von mir herausbringen würde, aber zu dem Zeitpunkt, da ich mit einundzwanzig eins fertiggestellt hatte, das mir gefiel, betitelt Baby Hermaphrodite Rabbits, meinte er, es sei nicht gut genug. Einige Jahre später, als ich bereits eine Weile Rock’n’Roll gespielt hatte, kontaktierte ich ihn wieder in der Hoffnung, dass er an der kommerziellen Publikation eines Buches interessiert sein mochte, für das ich zusammen mit Tom verantwortlich war und in das ich vollstes Vertrauen hatte – Wanna Go Out! von Theresa Stern (mehr darüber später) –, aber er äußerte sich nur verächtlich darüber, und das war das Ende unserer Beziehung.
Kapitel Sieben
Es war ein sonniger, warmer Spätnachmittag im April 2013. Ich unternahm einen Spaziergang. Zwei Blocks von meinem Apartment, an der Eleventh Street zwischen First und Second Avenue, sah ich ein Paar Sportsschuhe im Schaufenster von Tokyo Joe, ein kleines, von Japanern geführtes Unternehmen für gebrauchte Kleidung, das sich auf Haute Couture spezialisiert hat. Ich brauchte neue Schuhe, und diese sahen toll und ungetragen aus. Sie waren knöchelfrei und fußbetont, auf das cremefarbene Wildleder war ein komplexes Netzmuster aus schwarzem und tomatenrotem Leder aufgenäht, und sie kamen aus Italien. Sie passten mir perfekt und kosteten nur achtundfünfzig Dollar, während man sonst das Fünffache dafür blechen muss. Ich bezahlte und sagte, ich würde sie in ein bis zwei Stunden auf dem Nachhauseweg abholen.
Ich hatte vor, Richtung West Village zu schlendern. Viele Leute waren draußen und genossen das Wetter. Im Washington Square Park waren die hohen, rauen, aber behutsam knospenden Bäume auf eine transvestitenhafte Weise schön, ansonsten war der Park vor allem Beton und festgetretener Dreck. Der große Brunnen auf dem Hauptplatz war ohne Wasser. Wie so oft in den letzten Jahren, hatten ihn langweilige, angestrengt lustige Straßenmusikanten in Beschlag genommen, die von vielen Touristen mit selbstgefälligem Gelächter und Applaus angespornt wurden.
Als ich mit siebzehn nach New York kam, war der Park bekannt als Ort, wo Drogen zu bekommen waren. Vagabundierende Jugendliche mit Akustikgitarren hingen herum und hofften, dass etwas passiert. Es ist immer noch so, nur sind es heute Skateboardkids oder Gagtänzer statt Folksänger. Filmregisseur Harmony Korine und seine Skatepunks aus Privatschulen, einschließlich Chloë Sevigny, begannen ihre Filmkarriere, nachdem sie in den neunziger Jahren dort entdeckt worden waren.
Ich zog weiter zu der Straße, wo meine Großmutter gewohnt hatte. Sie starb vor ein paar Jahrzehnten, aber als ich ein Kind war und während meiner ersten Jahre in New York, wohnte sie in der Barrow Street 72. Für mich wird das West Village – früher hieß es Greenwich Village – vor allem der Ort ihres Apartments sein, und es ist immer noch mein Lieblingsviertel in Manhattan. Es gibt dort inzwischen manche Touristenfalle, aber selbst die Massenattraktionen sind relativ harmlos – eher »Künstler«-Cafés, Schachclubs, Musik- und Gitarrenläden, Sexshops und Leder- und Denim-Boutiquen als etwa der kitschige Disney-Store, Fastfood-Ketten und die Wucherläden für elektronische Geräte mit der Touristen anlockenden Aufschrift »Totalausverkauf wegen Umzug!« im Norden von Manhattan.
Das Herzstück von West Village ist immer noch ein ruhiges Gewirr baumgesäumter, enger, alter Straßen, einige noch mit Kopfsteinpflaster. Die Mietshäuser, Apartmentgebäude aus Sandstein mit ihren gusseisernen Treppengeländern und die kleinen Stadthäuser, einige sogar aus Holz, gehören zu den ältesten in der Stadt, und die meisten sind nur drei oder vier Stockwerke hoch, was den Himmel groß erscheinen lässt. Von der Straße aus kann man durch die schweren Schiebefenster dieser Häuser sehen, dass die Zimmer hohe Decken, hölzerne Wanddekorationen und viele Bücherregale haben. In jedem Block gibt es einige verblichene Ladenfronten, dahinter eine kleine Fleischerei oder einen Waschsalon oder Buchladen, eine Konditorei oder ein kleines Theater, ein Cabaret oder ein außergewöhnliches Restaurant. Man kennt die Geschichten von Fremden, die sich in diesen Waschsalons ineinander verliebt haben, besonders wenn es regnet.
Meine Großmutter wohnte an der nordöstlichen Ecke von Barrow und Hudson in einem von vier sechsstöckigen Gebäuden, die einen Hof mit Garten umschließen. Der raue Sandstein dieser Häuser ist rotbraun, durchädert mit rußigem Schwarz, was eher an triste Reihenhäuser im industriellen England als an den typischen amerikanischen Sandstein erinnert, aber für mich bedeutete dieser Ort Geborgenheit.
Ihr Apartment war winzig, kleiner als das, in dem ich seit 1975 wohne. Da war sie schon einige Jahre tot. Es hatte eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Bad und ein Schlafzimmer. Die Zimmer bekamen durch die alten Flügelfenster viel Licht, hatten alle Holzparkett, an den Wänden waren Drucke und in den Regalen einige Bücher, und im Schwarzweißfernseher lief die Serie Million Dollar Movie. Ein Speiseaufzug in der Küche wurde dazu benutzt, nach einem festgelegten Terminplan Müll in den Keller zu befördern.
Die wenigen Male, da wir sie in meiner Kindheit besuchten, konnte ich nicht schlafen, weil ich nicht an den Verkehrslärm gewöhnt war, der selbst noch im fünften Stock zu hören war. Ich lag im Bett übermüdet, aber auch glücklich, Teil der gewaltigen Aktivität der Stadt, der Maschinerie der Nacht zu sein, einer Nacht, die ganz anders als in Kentucky war.
Als ich ein junger Teenager war, hatten die Klamotten in den Läden an der West Fourth Street alle die Farben Aubergine, Creme und Hellbraun – waagerecht gestreifte T-Shirts, dicke Ledergürtel mit großen Messingschnallen, Cordjeans, Stiefel, Arbeitshemden, Sakkos aus Leder und Wildleder oder Arbeitsjacken. Es war das, was die Beatniks und Folkies trugen. Bei einem Besuch kaufte ich mir eine Levis Wildledercowboyjacke. Selbst als Teenager trachtete ich immer noch ein wenig danach, Cowboy zu sein.
Großmutters Apartment war für mich wie Supermans Telefonzelle. Wenn ich es betrat, wurde ich ein anderer Mensch oder vielmehr der Mensch, der ich zu sein glaubte, nicht derjenige, der ich in alltäglicher Gesellschaft war. Ich wurde nicht nur ein Bürger von Gotham City, sondern auch mächtig und interessant, weil Großmutter mich so behandelte.
Während der ersten Monate, da ich in New York lebte, ging ich alle ein bis zwei Wochen zum Abendessen zu ihr. Danach sah ich sie seltener, und die letzte Male, da ich sie besuchte, einige Jahre nach meiner Ankunft in der Stadt, war sie kaum noch fähig, sich um sich selbst zu kümmern. Ich hatte nicht die Reife, um zu wissen, wie ich damit umgehen sollte. Ich war ängstlich und verwirrt. Ihr Gedächtnis ließ nach, das Apartment wimmelte von Kakerlaken, und sie furzte dauernd, während sie herumlief. Sie war konfus, aber schalt sich selbst. Irgendwann nahmen Tante Phyllis und Onkel Dick sie bei sich auf, und ein oder zwei Jahre später, als sie ständige Betreuung benötigte, brachten sie sie in ein Pflegeheim.
Vierzig Jahre später, als ich vom Washington Square einige Blocks weiter westlich Richtung Village spazierte, fühlte ich mich von Großmutters Haus angezogen. Ihre Straße hatte sich kaum geändert. Sie war so ruhig wie früher. Den Eingang zu dem Komplex bildete nun ein hoher gusseiserner Torbogen, unter dem ein schmaler Schieferweg zwischen zwei der Gebäude in den Innenhof führte. Der Hof war klein und geradezu intim – vielleicht fünfzig Schritt breit und etwa fünfzehn Schritt quer. Er war symmetrisch aufgeteilt in sieben Blumenbeete, ihre Formen wurden durch die sich kreuzenden Wege gebildet, die die vier Eingänge der Gebäude in den Ecken des rechteckigen Hofs miteinander verbanden. In dem runden Beet in der Mitte thronte auf einem Sockel eine leere, große Steinurne. Jenseits davon, am hinteren Ende der Anlage, direkt gegenüber dem Weg zur Straße standen zwei niedrige Kirschbäume. Der Erdefeu in jedem Blumenbeet umringte eine Ansammlung von Tulpen, die in Tuschkastenfarben blühten. Sie waren überall, wohin ich auch schaute. Die Blumen hatten die unbewusste Freigebigkeit, die einen verstehen lässt, warum Frauen mit Blumen verglichen werden. Dankbarkeit überkam mich für die pure Großzügigkeit der Blumen, nicht unähnlich dem Gefühl, das die Brüste im Pullover einer vorbeigehenden, unbekannten Frau in mir hervorriefen. Ich schaute auf die Kirschbäume; auch sie blühten. Ihre verdrehten dunklen Zweige waren kaum unter dem überschäumenden Rosa zu sehen, das mich auch dazu brachte, jemandem danken zu wollen. Ich neigte meinen Kopf nach hinten. Ganz weit oben schwebte ein Ballon am Himmel. Und dann tauchte ein weiterer auf und dann noch einer, sechs oder sieben tauchten in leuchtenden Farben auf, die sich mit den Tulpen reimten. Ich dachte an meine Großmutter und ihre selbstlose Liebe. So etwas Ungewöhnliches gab es also, und wieder fühlte ich dankbar, nicht nur das Objekt dieser Liebe gewesen zu sein, sondern auch, dass Menschen so rein sein können. Für einen Moment verschwand meine eigene Unbedeutendheit.
Kapitel Acht
Das erste Human Be-In im Central Park fand Ende März 1967 statt. »Be-In« lässt mich an »donut« denken. Die DNS der Menschheit als alte Krapfen. Ich ging zur Sheep Meadow, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Leute standen herum und beäugten sich. Manche trugen kleine Glocken an ihren Kleidern. Ich sah bemalte Gesichter, Blumen überall, Pot wurde geraucht. Jugendliche winkten mit den Armen und sangen. Die Sheep Meadow ist eine große Wiese, und Tausende hielten sich dort auf. Drogen waren ein Thema, und man hörte Gesänge über Liebe. Die meisten dort waren merkwürdig angezogen – eine lockere Perlenkette hier, ein Gänseblümchen im Haar dort –, aber das traf ja gewöhnlich auch auf die Band Velvet Underground zu.
Wie das Flaggenschwenken von George Bush nach den Angriffen auf das World Trade Center war das Be-In abstoßender wegen seiner dogmatischen Unterstellung einer Einheit aller Beteiligten als wegen seiner dubiosen Grundidee. Für Bushs Amerika war die Tugend des selbstgerechten Patriotismus diese fragwürdige Idee, und die Hippies glaubten an die Praktikabilität universeller Freundlichkeit und Großzügigkeit. Die Menschen, die sich durch diese ungeprüften Annahmen miteinander verbanden, kamen mir idiotisch vor. Allerdings konnte ich auch nichts tun gegen meine Unfähigkeit, mich anzupassen.
Ich war verwirrt und irritiert. Menschenmassen nervten mich, und ich wusste, dass ich große Schwächen hatte, sah aber keine Möglichkeit, sie zu überwinden. Immerhin war ein Hochgefühl spürbar durch die große Anzahl von Leuten. Dieses Gefühl versprach ernsthafte Konsequenzen, bevor diese Generation alt wurde. Frühling lag in der Luft.
Ich erinnere mich, damals einen jungen Typen gesehen zu haben, der lange blonde Haare, einen Schnurrbart und ein kantiges Kinn hatte. Er war gutaussehend und scheinbar reich und selbstbewusst. Zusammen mit einem Freund hielt er sich in der Galerie des Gotham Book Mart auf. Vielleicht war es Dennis Hopper. Zumindest ähnelte er ihm. Vielleicht half er dabei, das Woodstock Festival zu organisieren. Er trug eine Westernjacke aus Wildleder mit sehr langen Fransen, auch auf der Rückseite beider Ärmel, und wenn er gestikulierte, machte das Leder diese psychedelischen Spuren in der Luft. Ich beneidete ihn um diese Jacke, die ihm die lässige Würde eines Cowboys verlieh. Ich wünschte, es gäbe eine Welt, in der ich sie tragen könnte. Lieber noch würde mich im elisabethanischen Stil kleiden, wenn man mich ließe.
Anfang Juni 1967, zwei Monate nach dem Be-In, kam Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band raus. Ich musste so tun, als ob ich das Album mochte, weil es mir von diesem Mädchen vorgespielt wurde, das ich in dem Büro kennenlernte, wohin mich eine Zeitarbeitsfirma geschickt hatte. Sie hatte auch Marihuana und ich wollte sie gerne ficken. Meine Mimik, Redeweise und Gesten waren die unscheinbare Fassade an einem riesigen Warenhaus der Hoffnung auf einen Fick. Sie war klein und kess, hatte eine süße Nasenspitze und unverhältnismäßig große Nasenlöcher, die eine »Nasenkorrektur« verrieten. Sie hatte eine schöne Haut – porenlos, weiß und glatt. Ich war ein bartloses siebzehnjähriges Strichmännchen, alles nur Haut und Knochen, mit zerzaustem Haar, das langsam über die Ohren wuchs, und einer altmodischen runden T. S. Eliot Schildpattbrille, Arbeitshemd, Jeans und hatte wenig Ansehen außer dem der verlorenen Jugend. Ich sah aus wie ein Dichter, hatte tiefliegende Augen und dicke Lippen, und ich rauchte Lucky Strike. Nan war etwa fünf Jahre älter als ich.

