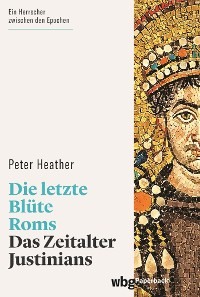
Die letzte Blüte Roms
Auch externe Ereignisse konnten ein Regime destabilisieren. Anfang der 380er-Jahre verlegte Kaiser Gratian seinen Hof von Trier nahe der Rheingrenze nach Norditalien und gliederte eine große Anzahl von Alanen in seine Feldarmee ein. Diese Alanen waren im Zuge des Chaos, das die Hunnen zu dieser Zeit in Ost- und Mitteleuropa erzeugten (und das auch Gratian veranlasst hatte, seine Operationsbasis nach Mailand zu verlegen, das näher am neuen Epizentrum der Bedrohung lag), aus ihrem alten Stammesgebiet am Schwarzen Meer vertrieben worden. Doch so sinnvoll und nachvollziehbar ihre Eingliederung für sich genommen auch war, sie brachte die bestehenden Machtverhältnisse innerhalb der westlichen Feldarmeen – insbesondere derer, die in Gallien stationiert waren – so sehr durcheinander, dass der Feldherr Maximus den allgemeinen Unmut dazu nutzte, sich als Usurpator (vorübergehend) zum Kaiser aufzuschwingen.
Nicht nur, wenn ein ranghoher Augustus von der Bildfläche verschwand, konnte das die höfische Politik ins Chaos stürzen. Ende der 410er-Jahre heiratete Constantius III. nach einer äußerst erfolgreichen Karriere beim Militär Galla Placidia, die Schwester des kinderlosen Kaisers Honorius, und zeugte mit ihr den voraussichtlichen Thronfolger Valentinian III.; Constantius wurde neben Honorius ganz ordnungsgemäß zum Augustus gekrönt. Doch als er im Jahr 421 plötzlich starb, kam das Gleichgewicht der weströmischen Politik sofort ins Wanken, und das obwohl Honorius immer noch auf dem Thron saß. Wir kennen nicht alle Details, aber offenbar gelang es den widerstreitenden Parteien nun, da Constantius fort war, Bruder und Schwester, die zuvor für einen liebevollen Umgang miteinander bekannt gewesen waren, gegeneinander aufzuwiegeln. Am Ende verkrachten sie sich so sehr, dass Galla mit ihrem Sohn nach Konstantinopel fliehen musste; ihre Flucht und Honorius’ plötzlicher Tod machten den Weg dann frei für den Usurpator Johannes.36
Doch von all den Unwägbarkeiten stellte eine militärische Niederlage noch immer die größte Gefahr für die politische Stabilität dar – aus naheliegenden Gründen. Valens’ gesamtes Regime löste sich mit einem Schlag auf, als der Augustus am 9. August 378 zusammen mit vielen seiner führenden Beamten bei der Schlacht von Adrianopel ums Leben kam. Doch auch einfache Rückschläge, die nicht gleich tödlich waren, konnten schlimme Folgen haben: Als die Vandalenexpedition Kaiser Majorians im Jahr 461 scheiterte, wandten sich so viele Unterstützer von ihm ab, dass sich der patrizische Feldherr Ricimer berufen fühlte, ihn abzusetzen und hinzurichten. Als es Stilicho nicht gelang, den Rheinübergang von 406 und die Usurpation Konstantins III. zu verhindern (die auf Stilichos offenkundige Unfähigkeit zurückzuführen war, den römischen Nordwesten vor Übergriffen zu schützen), verlor er drastisch an Einfluss auf Kaiser Honorius, den er mehr als ein Jahrzehnt lang aufgebaut hatte, seit er im Jahr 395 an die Macht gekommen war. Im August 408 wurde Stilicho gestürzt und hingerichtet. Doch als seine unmittelbaren Nachfolger nicht in der Lage waren, die politische Stabilität wiederherzustellen, wandten sich nach und nach die Unterstützer von ihnen ab. Es folgte eine ganze Reihe kurzlebiger Regime, von deren Protagonisten einige grausam ermordet wurden.37
Jede militärische Niederlage und sogar der bloße Anschein militärischen Unvermögens waren ein politisches Todesurteil, nicht nur ganz real, wenn ein Kaiser auf dem Schlachtfeld den Tod fand, sondern auch weil dies die Verschwörer und Intriganten auf den Plan rief. Schließlich gab es keinen größeren Beweis göttlicher Gunst – und damit kaiserlicher Legitimität – als militärischen Erfolg, und da dieser Erfolg scheinbar so leicht nachzuvollziehen war, galt auch das Gegenteil. Nichts zeigte deutlicher, dass dem aktuellen Regime der göttliche Beistand und damit die Existenzberechtigung fehlte, als ein militärisches Versagen, das die politische Stabilität beeinträchtigte. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass es viele Kaiser, wenn es um den Ausgang einer Schlacht ging, mit der Wahrheit nicht allzu genau nahmen.
Ein Remis in einen Sieg oder einen kleinen in einen großen Sieg umzudeuten – das waren die offensichtlicheren Strategien, wie Themistios sie in den Reden, die er Mitte des 4. Jahrhunderts für diverse Regime verfasste, bis zum Gehtnichtmehr wiederholte. Gleich in seiner ersten Rede behauptete er, der Vormarsch von Constantius II. auf Singara im Jahr 344 habe den persischen Großkönig Schapur zu Tode erschreckt, und verschleierte die Tatsache, dass es überhaupt keine Schlacht gegeben hatte. Das Gipfeltreffen von Valens und Athanarich im Jahr 369 wurde mit den Mitteln der Rhetorik als gewaltiger Triumph dargestellt (inklusive einem Flussufer voll demütig murmelnder Goten), obwohl (beziehungsweise gerade weil) das neue diplomatische Abkommen für eine viel größere Gleichberechtigung zwischen den Parteien sorgte als der Vorgänger, und das nach drei für das römische Militär äußerst frustrierenden Jahren. Auch den Umstand, dass es Theodosius im Anschluss an Adrianopel nicht direkt gelang, einen Sieg über die Goten zu erringen, beschönigte man mit einer ganzen Reihe von Behauptungen; so hieß es, der neu ausgehandelte Vertrag sei eben nur eine andere Art von Sieg und im Grunde genommen ein viel größerer Triumph.38
Diese Inszenierungsstrategien waren dermaßen verbreitet, dass es genauso üblich wurde, seine Rivalen der Übertreibung zu bezichtigen. Das Regime von Constantius II. setzte alles daran, die möglichen politischen Konsequenzen von Julians überwältigendem Sieg über die Alamannen in Straßburg im Jahr 357 zu begrenzen, indem es behauptete, jeder Trottel hätte einen Haufen »nackter Wilder« besiegen können. Wer ein Stratege sei, zeige sich allein im Kampf gegen die Perser im Osten.39
Der politische Imperativ, militärische Siege zu erringen (oder zumindest so zu tun), war so gewichtig, dass sich die beschönigende Präsentation politischer Strategien irgendwann auch auf deren Entwicklung selbst auswirkte: Wenn sie sonst nichts tun konnten, ließen die Kaiser an ungewöhnlichen Standorten entlang der Grenzen Festungen errichten. Ob man zur Zeit von Valentinian und Valens wirklich noch mehr solcher Anlagen brauchte, dürfen wir getrost bezweifeln, doch sie waren ein gutes Propagandamittel. Mitunter zeitigte diese Praxis allerdings ganz unerwartete Ergebnisse. Einmal ließ Valentinian in einem Gebiet, in dem die Römer, so war vorher vereinbart worden, nichts bauen durften, Befestigungsanlagen errichten; das veranlasste die empörten ortsansässigen Alamannen dazu, einen blutigen Aufstand vom Zaun zu brechen. Schon zu Beginn seiner Regentschaft hatte sich Valentinian seinen Steuerzahlern als Barbarenschreck präsentieren wollen. Nun senkte er einseitig den Wert der alljährlichen Geschenke für die Könige der Alamannen. Diese nutzten die Geschenke jedoch ihrerseits dazu, daheim ihr Prestige zu steigern und die Netzwerke ihrer Unterstützer zu unterhalten. Das Resultat waren weitere wütende Alamannenproteste und noch mehr Schwierigkeiten an der Rheingrenze.
Manche meinen, das Römische Reich habe jeden einzelnen aufgezeichneten Konflikt mit den Alamannen in der späten Kaiserzeit selbst initiiert – die Kaiser hätten nun einmal ständig unter dem Druck gestanden, militärische Siege vorzuweisen. Meiner Ansicht nach geht diese Argumentation zu weit, denn sie spricht den Menschen jenseits der Grenze letztlich das Handlungsbewusstsein ab. Dennoch: Der innenpolitische Zwang, klare Siege zu erringen, wird sich doch hier und da auf die kaiserliche Außenpolitik ausgewirkt haben.40 Und eben jener Zwang veranlasste manche Kaiser sogar dazu, ihre Niederlagen zu vertuschen.
Im Spätsommer 363 wurde Kaiser Julian beim Versuch, seine Armee aus dem Territorium der Perser herauszuholen, in einem Scharmützel getötet. Wie der Bericht des Ammianus Marcellinus deutlich macht, war Julians Streitmacht, obgleich in taktischer Hinsicht ungeschlagen, in eine strategische Falle gelockt worden. Sein Nachfolger Jovian sah sich gezwungen, einen geradezu demütigenden Friedensvertrag zu schließen: Die Perser erhielten die römische Regionalhauptstadt Nisibis sowie eine Reihe von Gebieten östlich des Tigris. Die naheliegende Option in puncto Propaganda wäre gewesen, diese Niederlage Julians unvorsichtigem Verhalten anzulasten – so wie es auch heute noch die meisten Regierungen tun, wenn sie für jedes aktuelle Problem ihre Vorgänger verantwortlich machen. Einer der Gründe, warum ich das britische Finanz- und Wirtschaftsministerium verließ und mich der Wissenschaft zuwandte, war die alberne offizielle Vorgabe, auf Fragen der Presse mit dem Satz zu antworten: »Ja, aber unter der letzten Regierung war die Situation noch viel schlimmer.« Doch sowohl die Münzen, die Jovian prägen ließ, als auch eine Rede, die er bei Themistios in Auftrag gab, machen deutlich, dass sich das neue Regime für eine viel unbequemere Option entschieden hatte: Man behauptete, die erniedrigenden Klauseln des Friedensvertrags seien für die Römer in Wirklichkeit ein Sieg. Niemand glaubte das, insbesondere als das Römische Reich den Persern dann wirklich Nisibis und viele weitere Territorien im Osten überlassen musste, doch das war auch gar nicht der Punkt: Der ideologische und politische Imperativ, siegreich zu sein, war so gewaltig, dass kein römischer Kaiser eine militärische Niederlage eingestehen durfte – nicht einmal dann, wenn er noch ganz am Anfang seiner Herrschaft stand und sie noch ganz plausibel seinem Vorgänger hätte anlasten können. Vor allem aber durfte man keine so gewaltige Niederlage gegen den Erzfeind der Römer eingestehen.41
Ein ganzes Netz sowohl aus ideologischen als auch aus praktischen politischen Notwendigkeiten machte die erfolgreiche Kriegsführung für alle römischen Herrscherhäuser zur allerobersten Priorität. Ein Kaiser, der im Bereich der militärischen Auseinandersetzungen versagte oder sich auch nur den Anschein gab, zu versagen, musste damit rechnen, dass umgehend seine Legitimität in Zweifel gezogen wurde, und er riskierte, das stets wackelige und improvisierte politische Gleichgewicht, das die Basis eines jeden funktionierenden kaiserlichen Regimes bildete, zu destabilisieren. Ein Herrscher mochte mit noch so imposanten zeremoniellen Mitteln zur Schau stellen, dass er von Gott eingesetzt war, und sich nach Kräften darum bemühen, jegliche Zweifel daran auszuräumen: In der Praxis beruhten alle kaiserlichen Regime auf einem fein gesponnenen Netz von Bündnissen, sowohl im Zentrum der Macht, also am Hof und in seiner unmittelbaren Umgebung, als auch zwischen dem Zentrum und den verschiedenen Regionen des Römischen Reiches. Militärische Siege spielten eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum ging, einflussreiche politische Akteure daran zu hindern, sich nach einer unmittelbaren Alternative umzusehen. Alle spätrömischen Vorgänger Justinians mussten diesen extrem anspruchsvollen Spagat bewältigen, in dessen Zentrum eben der (wahrgenommene) militärische Erfolg stand, und dieser Spagat sollte auch das Schicksal von Justinians Regime bestimmen. Angesichts der allumfassenden ideologischen und politischen Bedeutung des Sieges innerhalb dieses Systems ist es wenig verwunderlich, dass in der römischen Spätantike ein Großteil der Regierungsarbeit auf die praktischen Mechanismen effektiver Kriegsführung ausgerichtet war. Auch dieser Umstand hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die politischen Prozesse im Reich Justinians.
2
Geld und Männer für den Krieg
Heutzutage ist man in weiten Teilen der Welt davon überzeugt, die Aufgabe einer Regierung bestünde darin, für ihre Bürger Dienstleistungen zu erbringen und im Gegenzug von ihnen Steuern zu kassieren. Gesundheitswesen, Renten, Bildung, Sozialhilfe, Infrastrukturprojekte: All das wird in den Industrienationen, in denen das Nationalstaatenmodell entwickelt wurde, seit Langem aus der Steuerkasse finanziert – ein Modell, dem auch die Entwicklungsländer im Großen und Ganzen nacheifern. Dass auch die Sozialausgaben, insbesondere die ständig steigenden Kosten der medizinischen Versorgung und der Renten einer immer älter werdenden Bevölkerung auf diese Weise finanziert werden, stellt den Staatshaushalt vielerorts vor große Probleme. Vor allem seit der Wirtschaftskrise von 2008 verfolgen einige westliche Regierungen daher eine strikte Sparpolitik.
Historisch gesehen ist dieses ganze Phänomen extrem neu; es ist das Produkt des außerordentlichen Wohlstands der Industrienationen infolge der Industrialisierung und der wirtschaftlichen Entwicklungen im postindustriellen Zeitalter. Fast die gesamte Menschheitsgeschichte über waren die Staaten dieser Erde relativ unproduktiv und überwiegend agrarökonomisch geprägt; Regierungen, die einen Überschuss erwirtschafteten, der groß genug war, um all die genannten Aktivitäten durchzuführen, gab es im Grunde erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts. In der vormodernen Zeit und speziell im Fall des Römischen Reiches bestand die wichtigste, oft sogar die einzige Funktion der Regierung darin, Krieg zu führen. Folglich diktierte die jeweils aktuelle Art der Kriegsführung in den verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte zumeist auch die jeweilige Form der staatlichen Verwaltung und die politischen Beziehungen zwischen Herrschern und Beherrschten, die ihr zugrunde lagen.
Es gab zwei grundlegende Muster, nach denen vormoderne Staaten mit ihren vergleichsweise geringen Einnahmen und einer begrenzten bürokratischen Kapazität eine effektive Kriegführung organisieren konnten. Die erste, in mancher Hinsicht simplere Option bestand darin, einen ausgewählten Teil der Bevölkerung zum Militärdienst einzuziehen, üblicherweise für einen begrenzten Zeitraum pro Jahr. Als Gegenleistung wurden jenen, die diesen Militärdienst leisteten, Ländereien zur Verfügung gestellt, von deren Erträgen sie leben konnten. Ergänzt wurden diese Streitkräfte normalerweise durch eine relativ kleine Anzahl professioneller Soldaten, die dem Staat permanent zur Verfügung standen und die durch Steuereinnahmen finanziert wurden (im einfachsten Fall erhielten sie auch nur Sachleistungen wie Lebensmittel). Die zweite Option, und diese hatte sich in der römischen Welt durchgesetzt, war in administrativer Hinsicht viel komplizierter: Der Staat erhob so viele direkte Steuern, dass er eine komplette Berufsarmee finanzieren konnte.
Die Soldaten des Imperiums
Justinians Heer im 6. Jahrhundert bestand aus Berufssoldaten, doch es entsprach in vielerlei Hinsicht nicht mehr dem römischen Heer etwa unter Caesar oder Augustus, als eine in Legionen aufgeteilten Infanterie, die aus römischen Bürgern bestand, von nicht-römischen Hilfstruppen unterstützt wurde. Die klassische Legion der frühen Kaiserzeit war ungefähr 5000 Soldaten stark, und sie war aufgeteilt in zehn Kohorten, die jeweils von einem Zenturio befehligt wurden. Ihr stand mehr oder weniger die gleiche Anzahl an Hilfssoldaten gegenüber, die keine römischen Bürger waren; diese waren in Infanterie-Kohorten und Kavallerie-alae (Flügel) aufgeteilt. Von der Zeit des Augustus an stieg die Zahl der Legionen immer weiter, bis während der Dynastie der Severer zu Beginn des 3. Jahrhunderts mit 33 Stück der Höchststand erreicht war. Somit standen rund 350 000 Römer unter Waffen, dazu eine ähnliche Anzahl an Hilfssoldaten.
Der allergrößte Teil der römischen Soldaten war an den Grenzen des Reiches stationiert: im Norden Britanniens, entlang Rhein und Donau, in Mesopotamien, Armenien und an der persischen Grenze; kleinere Kontingente patrouillierten in der Wüste Ägyptens und im übrigen Nordafrika bis ins heutige Marokko.
Für die großen Feldzüge wurden Kontingente aus allen Legionen, die sich in Reichweite befanden, zusammengezogen; gesamte Legionen – jede für sich eine kleine Expeditionsstreitmacht – wurden im Imperium nur selten von A nach B bewegt.1
Zu Justinians Zeit hatte sich das römische Heer unter dem Druck zweier aufeinanderfolgender Phasen militärischer Krisen so stark verändert, dass es mit dem Heer des 3. Jahrhunderts kaum noch etwas gemein hatte. Wenn wir wissen wollen, wie Justinians Heer aussah, können wir die berühmte Notitia dignitatum zurate ziehen, die eine nahezu vollständige Auflistung der Schlachtordnung des römischen Heers in der Osthälfte des Reiches beinhaltet. Zwar stammt dieses Handbuch bereits aus den 390er-Jahren, doch juristische Dokumente aus dem 5. Jahrhundert, die sich mit militärischen Fragen befassen, und das eher episodische Bild des oströmischen Heers in Aktion, das uns narrative Quellen des frühen 6. Jahrhunderts vermitteln, machen deutlich, dass sich das Grundmuster militärischer Organisation in den dazwischenliegenden 130 Jahren nicht grundlegend verändert hatte. In Phasen mit schweren Gefechten konnte es passieren, dass einzelne Einheiten aufgerieben wurden, und neue Bedrohungen erforderten spezielle Bemühungen in Sachen Rekrutierung. Sechzehn oströmische Regimenter schwerer Infanterie, die in der Schlacht von Adrianopel im August 378 den Tod fanden, wurden nicht ersetzt, und die Hunnenkriege der 440er-Jahre bescherten große Verluste und beförderten umfassende Rekrutierungsbemühungen in Isaurien (im Süden Zentralanatoliens).2
Doch auch wenn einzelne Einheiten kamen und gingen – die allgemeine Form der militärischen Organisation blieb in Ostrom weitgehend die gleiche. Im ausgehenden 4. Jahrhundert war das alte Muster großer Legionärseinheiten, die in bestimmten Abständen entlang der wichtigen Außengrenzen des Reichs stationiert waren, einem viel komplexeren System militärischer Einheiten und Stellungen gewichen, das bis Mitte des 6. Jahrhunderts bestehen blieb. Es gab nun drei große oströmische Heeresgruppen: Den höchsten Status genossen die zentral stationierten Praesentalis-Armeen, die in zwei getrennten Korps organisiert waren, mit je einem kommandierenden Feldherrn (magister militum praesentalis); dann kamen drei regionale Feldarmeen (eine in Thrakien, eine in Illyrien, die dritte an der persischen Front, jeweils wieder mit einem eigenen magister militum) und schließlich eine ganze Reihe Grenzschutztruppen (limitanei), die in befestigten Posten an oder nahe der Reichsgrenzen stationiert waren. Letztere hatten den niedrigsten Status und waren in regionalen Gruppen organisiert, denen jeweils ein dux (»Anführer«) vorstand.
Die Anzahl und der Typus der militärischen Einheiten innerhalb jeder Heeresgruppe hatten sich ebenfalls verändert, auch wenn das Wort »Legion« im Titel vieler Einheiten überlebt hatte. Insbesondere bei den limitanei gab es einige Einheiten, die direkte Nachfahren uralter Formationen waren: Die Legio V Macedonica zum Beispiel war 43 v. Chr. von Julius Caesar eingerichtet worden und existierte im Ägypten des 7. Jahrhunderts n. Chr. immer noch. Doch von der Organisation her unterschied sie sich, wie alle spätrömischen Heeresverbände, stark von den früheren Legionen. Der Standardbegriff für eine solche Einheit war jetzt numerus (auf Latein) bzw. arithmos (auf Griechisch). Es gab keine Heereseinheiten mehr, die wie die alten Legionen 5000 Mann stark waren (in etwa wie eine heutige Brigade). Wir wissen es nicht genau, doch man darf davon ausgehen, dass selbst größere Infanterie-Formationen nicht mehr als 1000 bis 1500 Soldaten zählten (in etwa wie ein heutiges Regiment). Außerdem gab es sowohl bei den limitanei an den Grenzen als auch bei den regionalen Feldarmeen und den Praesentalis-Armeen viel mehr Kavallerieeinheiten als früher, doch diese waren noch kleiner und bestanden aus kaum 500 Mann.
Auch die alte Kluft zwischen Legionären mit römischem Bürgerrecht einerseits und Hilfstruppen, die keine Bürger waren, andererseits existierte in dieser Form nicht mehr. Stattdessen gab es nun drei verschiedene Hauptkategorien von Soldaten, die sich in Höhe des Soldes und Ausrüstung unterschieden. Die Praesentalis-Armeen und die regionalen Feldarmeen bestanden aus palatini (den ranghöchsten Soldaten) und comitatenses (mit dem zweithöchsten Status), die Grenztruppen aus limitanei und/oder ripenses.3 Die Statusunterschiede waren eng mit der militärischen Kapazität verbunden. Als eine Kavallerieeinheit, die in der Kyrenaika gegen Wüstenräuber vorging, den Status der Feldarmee (als comitatenses) verlor und zu limitanei herabgestuft wurde, verlor sie – sehr zum Verdruss von Synesios von Kyrene – das Anrecht auf zusätzliche Pferde und Vorräte, mit denen sie möglicherweise effektiver gegen die lästigen Wüstenräuber hätte vorgehen können. Auch von der Kürzung ihres Solds werden die Soldaten kaum begeistert gewesen sein. Dennoch sollte man nicht annehmen, dass die limitanei nichts ausrichten konnten. Früher sahen Historiker sie zumeist als Bauern, die sich nebenbei als Soldaten verdingten und zu kaum mehr in der Lage waren, als ein wenig an der Grenze zu patrouillieren und hier und da eine Zollkontrolle durchzuführen. Aber auch wenn sich ihre Einsatzbereitschaft und der Grad ihrer militärischen Ausbildung wahrscheinlich von Grenze zu Grenze erheblich unterschieden, waren zumindest die limitanei der Ost- und der Donaufront durchaus kampferprobt. Die Kriegsführung im Osten setzte hauptsächlich auf lange Belagerungen, und die Streitkräfte diverser großer römischer Festungen bestanden aus limitanei. Bei vielen Feldzügen waren sie in der Anfangsphase an den meisten Kämpfen beteiligt. Dasselbe galt für die Donaufront, wo es das gesamte 5. Jahrhundert über immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen kam. Und auch bei den ganz großen Feldzügen kamen neben den Feldarmeen manchmal auch Einheiten der limitanei zum Einsatz.4
Ein Großteil dieser Neuorganisation des Heeres lässt sich auf eine Zeit extremer militärischer und politischer Instabilität zurückführen, die man gemeinhin als »Reichskrise des 3. Jahrhunderts« bezeichnet. Der größte destabilisierende Faktor damals war der Aufstieg Persiens zur Supermacht unter einer neuen Dynastie: In den 220er-Jahren lösten die Sassaniden ihre Rivalen, die Arsakiden, ab und fanden neue Mittel und Wege, die gewaltigen Ressourcen des heutigen Iran und Irak unter ihre Kontrolle zu bringen, um die römischen Gebiete im Osten angreifen zu können. Dieser Vorgang wirkte sich extrem negativ auf die allgemeine strategische Stellung des Römischen Reiches aus. In einer großen Felsinschrift, den Res gestae divi Saporis, zählte der persische Großkönig Schapur I. (240/242–270/272) auf, was er alles vollbracht hatte:
Ich bin der Mazda verehrende göttliche Schapur, König der Könige, (…) aus dem Geschlecht der Götter, Sohn des Mazda verehrenden göttlichen Ardaschir, des Königs der Könige (…). Als ich zum Herrscher über die Länder eingesetzt wurde, versammelte der Caesar Gordian eine Armee aus Soldaten aus dem ganzen Römischen Reich (…) und marschierte (…) gegen uns. Ein großer Kampf zwischen beiden Parteien fand an den Grenzen von Assyrien bei Meschike statt. Der Caesar Gordian wurde getötet und die römische Armee vernichtet. Die Römer riefen Philipp zum Caesar aus. Und der Caesar Philipp kam und bat um Frieden, und er zahlte für ihr Leben 500 000 Denare und wurde uns tributpflichtig. Aber wieder log der Caesar, und er tat Armenien Unrecht. Wir marschierten gegen das Römische Reich und vernichteten eine römische Armee von 60 000 Mann in Barbalissos. Zuerst griffen wir das Land Syrien an und die Länder und Ebenen, die oberhalb davon lagen, und wir verwüsteten sie. Und [wir eroberten] auf dem Feldzug (…) 37 Städte mit den umliegenden Gebieten. Bei der dritten Auseinandersetzung (…) überfiel uns der Caesar Valerian. Er hatte eine Streitmacht von 70 000 Mann bei sich (…). Jenseits von Carrhae und Edessa fand eine große Schlacht zwischen uns und dem Caesar Valerian statt, und wir nahmen ihn wie auch alle anderen Befehlshaber der Armee mit eigenen Händen gefangen (…). Auf diesem Feldzug eroberten wir zudem (…) 36 Städte mit den umliegenden Gebieten.5
Das Römische Reich benötigte drei Politikergenerationen, um sich von dieser Abfolge katastrophaler, erniedrigender Niederlagen zu erholen und das Gleichgewicht an der Ostfront wiederherzustellen – und damit auch in seinen Strukturen wieder zu funktionieren.
Die unmittelbare Reaktion war, wie kaum anders zu erwarten, eine komplette Neuausrichtung des gesamten Militärapparats des Imperiums. Dies beinhaltete auch die Einrichtung neuer militärischer Einheiten. Die persischen Elitetruppen des 3. Jahrhunderts waren die sogenannten Kataphrakte: Diese schwer bewaffneten Lanzenreiter waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Armeen von Gordian, Philipp und Valerian so große Verluste erlitten. Als Reaktion darauf erhöhte Rom ganz beträchtlich die Zahl der Kavallerieeinheiten, die den Kommandanten zur Verfügung standen, und es entstand eine ganz neue Art von Kavalleristen: die clibanarii oder »Panzerreiter«, bei denen Pferd und Reiter von oben bis unten gepanzert waren. Clibanarii waren auch Ende des 4. Jahrhunderts noch Teil der Feldheere im Osten des Reiches.6